Klangwelten / Betörendes, harter Stoff und ziemlich Überflüssiges

 Betörender Grunge-Folk aus der Wüste
Betörender Grunge-Folk aus der Wüste
Big Thief: Two Hands
Nahe der mexikanischen Grenze liegt Sonic Ranch, das größte Aufnahmestudio-Komplex der Welt. Hier zog sich dieses vier köpfige Indie/Alt-Rock-Gespann unmittelbar nach der Veröffentlichung des dritten Longplayers, U.F.O.F., zurück, um nach nur fünf Monaten „Two Hands“ rauszuhauen. Etwas esoterisch beschreibt die Band „Two Hands“ als rauer Erdzwilling von „U.F.O.F“, welches mit offensichtlichen Anleihen an die Scifi-Kultur luftigere Höhen anstrebte.
Wenn The National vor kurzem eine Coverversion des Big-Thief-Songs „Not“ während ihrer rezenten Tournee zum Besten gibt und man die Note 9.0 auf Pitchfork erhält, dann ist man zumindest theoretisch im Indie-Rock-Olymp angekommen und scheint damit unantastbar zu sein.
Aufs Essenzielle heruntergeschraubt saßen Big Thief während der Aufnahmen zusammen und dieser ungefilterte Live-Sound kommt auch beim Hörer an. Von allen Instrumenten sticht aber noch immer Adrianne Lenkers raue, zerbrechliche Stimme am meisten heraus. Tonhöhe und Timbre dienen als Vehikel für zärtliche bis brutale Lyrics, deren Dualität eigentlich der Leitfaden von „Two Hands“ ist.
Mutmaßlich könnte dies einige abschrecken, die sich die weniger herausfordernde, fast schläfrige Intimität von „Majesty“ oder die autobiografische Nacktheit von „Capacity“ zurückwünschen. Doch der Zauber von „Two Hands“ liegt in dem Nexus von laut und leise, der die Intimität stellenweise kippen lässt und trotzdem sehr ergreifend wirkt.
Nirgends sticht diese dynamische Bandbreite so heraus wie in „Not“. Lenkers Stimme schraubt sich kontinuierlich herauf, wird von Buck Meeks türmenden Riffs untermalt, bis sie gegen Ende schreiend aus ihrer Seele heraustrompetet. Politisch wird es nur auf „Forgotten Eyes“, wenn sie etwa „Everybody needs a home and deserves protection“ singt, um wenig später einzuräumen: „Is it me who is more hollow as I’m quickly passing by?“
Die letzte Strophe des Albums endet mit dem Statement „She keeps coming back“. Eigentlich schon fast ein Mantra für diese unerschöpfliche Band. Alasdair Reinert
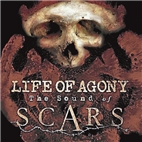 Gelungene Fortsetzung ihres Debüts
Gelungene Fortsetzung ihres Debüts
LIFE OF AGONY: The Sound Of Scars
26 Jahre nach ihrem phänomenalen Debüt „River Runs Red“ legen Life Of Agony mit ihrem mittlerweile sechsten Studioalbum den verspäteten konzeptionellen Nachfolger „The Sound Of Scars“ nach. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan: Hinter dem Schlagzeug sitzt statt Sal Abruscato (Ex-Type O Negative) nunmehr Veronica Bellino und Keith Caputo ist nach seinem Transgender-Outing zu Mina Caputo geworden. Neben ihr sind von der Urbesetzung außerdem noch Joey Z. (Gitarre) und Alan Robert (Bass) dabei.
Über die Jahre hat sich auch die Musik der New Yorker, die schon zwei Reunions (2002 und 2014) erlebt haben, gewandelt. Dennoch ist der Sound, der ihren Erstling ausmacht(e), noch herauszuhören: siehe etwa das vor Kraft strotzende „Once Below“ und den Ohrwurm „Lay Down“, laut Band eine „Hymne für Überlebende“.
Apropos Überlebende: Das von der mit einem Grammy Award ausgezeichneten Sylvia Massy (Tool, Johnny Cash) produzierte Album knüpft dort an, wo „River Runs Red“ endete – bei dem Versuch des im Mittelpunkt der Texte des Erstlings stehenden Teenagers, sich das Leben zu nehmen. Hörte man am Ende des Debüts nach einem Selbstmordversuch dessen Blut tropfen, so beginnt das aktuelle Album mit eben jenem Tropfen. Nicht nur klanglich, auch inhaltlich wird die Geschichte des Protagonisten weiter erzählt. Er lebt nun mit seinen physischen und psychischen Narben weiter. Sein Überlebenskampf wird in dynamisch-emotionalen Songs, deren zentrales Element Mina Caputos Stimme ist, und kürzeren Hörspieleinlagen offengelegt.
Keine Frage: Das Warten auf die „River Runs Red“-Fortsetzung hat sich gelohnt. Life Of Agony wiederholen sich nicht und können qualitativ an die beste Phase ihrer Karriere anknüpfen.
Kai Florian Becker
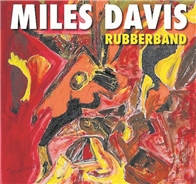 Ziemlich überflüssig
Ziemlich überflüssig
MILES DAVIS: Rubberband
Leider kann man den Mann nicht mehr nach seiner Meinung fragen, denn er ist 1993 gestorben: der große Miles Davis, der so ziemlich in jedem Jahrzehnt, in dem er musikalisch aktiv war, den Jazz revolutioniert hat.
In den 80er-Jahren hat er allerdings – sieht man mal von „The Man With The Horn“ und „Tutu“ ab – wie so viele andere namhafte Künstler einige Werke veröffentlicht, die heute kaum noch unter Jazzfans Beachtung finden, da das meiste aufgrund des übertrieben eingesetzten Sound-Designs der 80er unhörbar geworden ist. Über diese Schandtaten, bei denen massenweise brauchbare Songideen mit Hilfe von neuen Errungenschaften wie Elektro-Drums, Handclapping (und anderen von Drumcomputern produzierten Scheußlichkeiten), Yamaha-Synthesizern oder dem Fairlight-Computer massakriert wurden, kann man heute nur noch schmunzeln und kopfschüttelnd ein „ja, ja, so waren sie, die 80er“ dahinseufzen, wenn man eine entsprechende Platte hört.
Ärgerlich und absurd wird es jedoch, wenn Material aus diesem Jahrzehnt verfremdet wird, um es für den Musikmarkt anno 2019 wieder attraktiv zu machen und somit eine potenzielle neue Hörerschaft zu erschließen. Diesen Frevel haben Vince Wilburn Jr., Randy Hall und Zane Giles begangen.
Wilburn ist ein Neffe von Miles Davis und Nachlassverwalter seines Onkels, Hall und Giles sind die Produzenten, die die ursprünglichen „Rubberband“-Sessions im Jahr 1985 leiteten und die nun die Originalaufnahmen überarbeiteten und fertigstellten. Statt, wie ursprünglich geplant, das Zeug lediglich neu abzu mischen, kamen sie auf die glorreiche Idee, neue Spuren hinzuzufügen, Sänger ins Studio zu holen, um über einige Tracks zu singen, und dergleichen. Sie fragten bei Al Jarreau (der wenig später verstarb), Bruno Mars und Chaka Khan (die ablehnten) an und landeten schließlich bei den Popstars Ledisi und Lalah Hathaway.
Die R&B-Sängerin Ledisi performt den Eröffnungstrack „Rubberband of Life“ und macht ihn zu dem einzigen hörenswerten Song des ganzen Albums. Auf originelle Weise wird Miles’ Stimme an einigen Stellen hinzugemischt, die Trompete des Großmeisters klingt hervorragend und das Stück hat einen sehr lässigen Funk-Groove.
Den Rest kann man fast integral vergessen. Da den Produzenten der 80er-Einschlag zu stark
war, legten sie zeitgenössische Sounds über die Original-Takes, um sie so in die Gegenwart zu führen.
So spielt das Album in zwei unterschiedlichen Zeitebenen, ist weder Fisch noch Fleisch und hat nur noch entfernt etwas mit Jazz tu tun, obwohl der Meister selbst kreativ und gut aufgelegt ist. Bei dem Track „Maze“ ist es eine Freude, die Duelle, die er sich mit Gitarrist Mike Stern liefert, zu verfolgen.
Ob Miles allerdings seinen offenen, nicht gemuteten Trompetensound mit dem an einigen Stellen übertriebenen Delay-Effekt so durchgewunken hätte, ist fraglich. Ebenso fraglich wie das gesamte Unternehmen, an Aufnahmen herumzufummeln, die ein Künstler nicht persönlich freigegeben hat, und sie 26 Jahre nach dessen Tod zu veröffentlichen. Das Cover, das wie so oft ein selbst gemaltes Bild des Musikers zeigt, ist allerdings sehr hübsch. Gil Max
- Luxair streicht zwei Flüge nach technischen Problemen - 21. Januar 2025.
- Überfall nach Online-Date: Täter bedrohen Opfer mit Schusswaffe und fliehen - 21. Januar 2025.
- Tankstelle der Aire de Capellen schließt für Autos - 21. Januar 2025.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos