Deutscher Buchpreis / Autorinnen der Short- und Longlist: Mehr als nur Selbstbeschau

Die Shortlist für den „Deutschen Buchpreis 2024“ steht fest
Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2024* wurde am 17. September bekannt gegeben. Ein paar persönliche Lese-Empfehlungen, deren Auswahl einen Schwerpunkt auf die Romane von Autorinnen legt. Noch nie waren so viele Romane von Frauen für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Kleine Fluchten ins Zwischen-Netz: Martina Hefter – „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“

Juno chattet mit Männern, sogenannten Love-Scammern, die über Social-Media-Kanäle Frauen mittleren Alters anbaggern, um so an Geld zu kommen. Doch statt auf sie reinzufallen, werden die Gespräche mit diesen Männern für Juno zur regelrechten Sucht und zu einer Form von Freiheit. Denn in diesen Gesprächen, vor allem mit Benu, kann sie – im Gegensatz zu ihrem Alltag, in dem ihr Orbit stets um ihren kranken Mann, den großen Jupiter, kreist – sein, wer sie will, ohne Konsequenzen: „Eigentlich schauspielerte sie nur dann, wenn sie nicht auf einer Bühne stand. An den normalen Tagen. Da spielte sie, ein normaler Mensch zu sein. Eine normale Juno.“ Durch die Flucht ins Internet wird sie zur Lügnerin, aber wer belügt hier eigentlich wen?
Der Roman ist nicht nur vom Sujet her originell, er gibt – im Vergleich zu anderen Romanen der diesjährigen Longlist – Einblicke in das prekäre Leben von Künstler*innen, die wirklich finanziell herumkrebsen und sich mit den Preisgeldern und Förderungen von Pizzazungen ernähren …
Der Leipziger Schriftstellerin und Performance-Künstlerin Martina Hefter, die seit jeher viele ihrer Texte szenisch umsetzt, ist mit „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ ein fesselnder Roman gelungen, den Frau nicht so schnell weglegen, geschweige denn vergessen wird. Ein kleiner Geniestreich.

Martina Hefter: „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“, 224 Seiten, gebunden, erschienen bei Klett-Cotta, Stuttgart 2024, 22 Euro.
Ein Leben auf der Durchreise: Iris Wolff – „Lichtungen“

„Wer einmal weggegangen ist, bleibt sein Leben lang ein Gehender“, so ein Schlüsselsatz dieses Romans. Iris Wolffs „Lichtungen“ beschreibt die Liebesgeschichte zwischen Lev und Kato als pars pro toto über das Schicksal von Migrant*innen.
Die in Rumänien geborene und als Kind nach Deutschland emigrierte Schriftstellerin Wolff hat über zwei Menschen geschrieben, die aufbrechen und nirgendwo mehr ankommen können. Ihr fünfter Roman setzt in Zürich ein. Ihre Protagonisten Kato und Lev, beide um die vierzig, kennen sich seit frühester Kindheit, seit sie gemeinsam im Norden Rumäniens aufwuchsen. Das Ende der Ceausescu-Ära stellt sie beide vor ein großes Nichts: „Nichts hatten sie sich sehnlicher gewünscht als die Öffnung der Grenzen, und als sie offen waren, wussten sie nicht, was mit dieser Offenheit zu tun war.“
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hielt es Kato zu Hause nicht mehr aus. Zusammen mit Tom, den es als Abenteurer nach Rumänien verschlagen hat, bricht sie mit dem Fahrrad in den verheißungsvollen Westen auf und schlägt sich allein als Straßenkünstlerin durch. Lev dagegen bleibt als Sägewerkarbeiter in Rumänien.
Fünf Jahre haben sich die beiden nicht gesehen, bis Kato ihrem Jugendfreund eine Postkarte mit den schnöden Worten „Wann kommst du?“ zuschickt. Hier beginnt der Roman, in dem die Lebenswege der beiden Kapitel für Kapitel rückwärts nacherzählt werden, zwei Stränge, die sich hin- und wieder kreuzen … Viel verändert sich und es bleiben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kaum mehr Gewissheiten. Ob Lenau ein rumänischer oder deutscher Dichter war, vermag so nach den jahrhundertelangen Grenzverschiebungen keiner mehr zu sagen.
Sprachlich brillant erzählt Wolff die Liebesgeschichte von Kato und Lev im Rumänien von Ceausescu und verzichtet gänzlich auf moralisierende Kommentare. Ihr Roman fasziniert durch seine poetische Sprache und die klugen Gedankengänge.

Iris Wolff: „Lichtungen“, 256 Seiten, gebunden, erschienen bei Klett-Cotta, Stuttgart 2024, 24 Euro.
„Auch die Sprache ist eine Waffe“ – Ronya Othmann: „Vierundsiebzig“

„Angesichts dessen, was 2014 in Shingal geschah und was die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament später Völkermord nannten, versagt die Sprache“, schreibt Ronya Othmann schon zu Beginn ihres Romans „Vierundsiebzig“. Das über 500 Seiten lange Buch ist eine Reise zu den Ursprüngen des Massenmordes an den Jesiden durch den „Islamischen Staat“ (IS). Der Recherche-Weg und Schreibprozess führen in die Camps und an die Frontlinien, zu Verwandten oder in ein verlassenes jesidisches Dorf in der Türkei.
Anhand von Zeugenaussagen und historischen Dokumenten trägt die Journalistin Othmann in konsequenter Selbstbefragung Material zusammen. Sie trennt die Nähte ihrer Erkenntnisse auf und knüpft sie wieder neu zusammen: „Ich schreibe. Und später traue ich dem Geschriebenen nicht mehr. Ich traue dem Wir nicht mehr, und ich traue dem Ich nicht mehr. Ich schreibe, und wenn ich etwas aufgeschrieben habe, denke ich, das ist die Wahrheit. Und dann lese ich es wieder und denke, man müsste es noch ein zweites Mal schreiben und ich schreibe es ein zweites Mal und denke, so ist es richtig, und dann lese ich es, und nachdem ich es gelesen habe, denke ich, obwohl alles daran stimmt, ist es nicht die Wahrheit.“
Immer wieder stößt die Autorin an Grenzen und lotet das Sagbare in der Sprache aus: „Die Sprachlosigkeit strukturiert den geschriebenen Text, legt seine Grammatik fest, seine Form, seine Worte.“

So wird die Frage nach dem Warum in Othmanns erschütterndem Roman zur ausformulierten Sprachlosigkeit. Dieser dichte Roman ist schwere Kost, doch eine Wucht, und Othmann berechtigte Anwärterin auf den Deutschen Buchpreis.
Ronya Othmann: „Vierundsiebzig“, 508 Seiten, gebunden, erschienen bei Rowohlt, Hamburg 2024, 26 Euro.
Deutschlands Weg in den Abgrund: Nora Bossong – „Reichskanzlerplatz“

Noch eine NS-Geschichte, über 290 Seiten? Und dann noch über Magda Goebbels, die Vorzeigemutter des Großdeutschen Reichs! Das geht doch schief, denkt man sich und durchblättert anfangs skeptisch Bossongs Roman. Bereits der Titel „Reichskanzlerplatz“ wirkt reißerisch und bereitet Unbehagen … Doch das Unbehagen ist intendiert. Es wird sich bis zum Ende der Lektüre nicht legen. Am einstigen Berliner Reichskanzlerplatz, dem heutigen Theodor-Heuss-Platz, lebte Magda Goebbels nach ihrer Scheidung von Günther Quandt und brachte auf Soiréen wohlhabende Industrielle mit Hitlers engstem Kreis in Verbindung. Die Quandts stehen prototypisch für Großindustrielle, die im NS noch reicher wurden.
Der fiktive Ich-Erzähler Hans Kesselbach entführt die Leser*innen in die Zeit zwischen 1919 und 1945. Nora Bossong, die ihre Geschichte aus der Perspektive des homosexuellen Hans, einer Randfigur, erzählt, hat einen Roman mit Sogwirkung geschrieben. In der Schule freundet sich Hans mit Hellmut Quandt an, dem Sohn des einflussreichen Industriellen. Bei ihm zu Hause lernt er auch Magda kennen, Hellmuts sehr junge Stiefmutter, die später in zweiter Ehe zu Magda Goebbels wird: „Mit ihm glaubte sie in den Himmel aufzusteigen, und alles darunter überließ sie der Hölle.“ Eine scheinbar zufällige Verkettung von Zufällen …
Wie bereits in „Schutzzone“ (2019) schafft es Bossong, die psychologische Entwicklung ihres Protagonisten mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu verweben und macht das sich verändernde Klima der Goldenen 1920er greifbar. In „Reichskanzlerplatz“ zeichnet sie eine Gesellschaft, die dem Untergang zusteuert. Mit Blick auf das Erstarken der Rechtsextremen drängen sich bei der packenden Lektüre Parallelen zum Heute auf. Ein sorgfältig durchkomponierter Roman, der es verdient gehabt hätte, für die Shortlist nominiert zu werden.

Nora Bossong: „Reichskanzlerplatz“, 296 Seiten, gebunden, erschienen bei Suhrkamp, Berlin 2024, 25 Euro.
Geliebt-verhasste Mischpoke: Dana von Suffrin – „Nochmal von vorne“
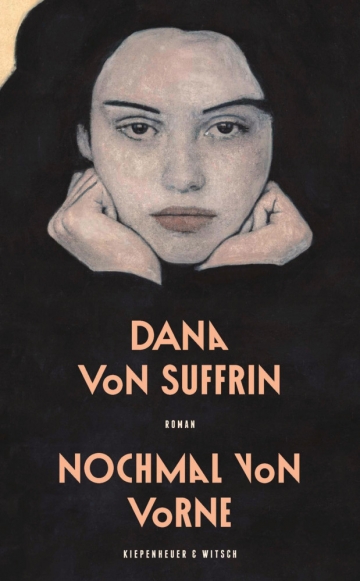
In der Familie Jeruscher ist jeder mit jedem verstritten. Der Roman setzt mit dem Tod des Vaters ein. Seine jüngere Tochter, die Ich-Erzählerin, holt im Krankenhaus den Totenschein ab. Es folgt die Auflösung der Wohnung, eine Reise in die Vergangenheit: „Ich träume davon, wie wir alle um einen Tisch sitzen, drei Generationen der Familie Jeruscher vereint, drei Generationen, die niemals für länger als ein paar Tage vereint waren (zum Glück, hätte meine Mutter gesagt), und dass wir uns so ähnlich sahen, ähnlich geendet sind, ist sicher nur ein Zufall.“ Sukzessive entsteht die Familiengeschichte: Sie erzählt von der Flucht der jüdischen Großeltern aus Siebenbürgen, vom Onkel Arie aus Tel Aviv, einem Schürzenjäger und davon, wie ihr Vater einst über das Bein ihrer Mutter stolperte und so die Ehe der Eltern, ein einziges Missverständnis, ihren Lauf nahm.
Ihre Schwester ist eine durchgeknallte Mythomanin und ihre Mutter seit einer Thailand-Reise verschollen: „Meine Mutter hatte, wie beinahe alle 80er-Jahre-Mütter in unserer Nachbarschaft, ihr Haar so lange mit L’Oréal Brilliance platinblond gefärbt, bis es wie ein langer trauriger Wildschweinborstenpinsel aussah von der Sorte, wie wir sie im Kunstunterricht benutzten.“ Ihre katholische Mutter nennt ihren Chef „Eichmann“ und verliert deshalb ihren Job. Von ihrer jüdischen Großmutter Zsazsa, die bis zu ihrem Lebensende in einem Altenheim in Holon sitzt, wird sie zeit ihres Lebens als Gojte weggestoßen und systematisch mit falschem Namen angesprochen: „Elisabeth heißt die, sagte Zsazsa, und dann sagte sie wie zu einem dummen Kind, das unbedingt recht behalten wollte, gut Veronika, verzeih, aber kein Mensch versteht eure merkwürdigen Geschichten, und damit meinte sie natürlich all das, was im Neuen Testament passierte, aber man musste ehrlicherweise hinzufügen, dass auch das Alte Testament unserer Familie nicht weniger abstrus vorkam, und am nächsten Tag begann Zsasza dann wieder, unsere Mutter Elisabeth oder Verena zu nennen.“
Atemlos und komisch erzählt Suffrin über eine Familie voller Neurosen. Auch dieser Roman wäre es wert gewesen, für die Shortlist nominiert zu werden, denn bei der Lektüre kringelt man sich vor Lachen.

Dana von Suffrin, „Nochmal von vorne“, 240 Seiten, gebunden, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024, 23 Euro.
- Die EU und Trump: Beißhemmung in Brüssel - 21. Januar 2025.
- Opposition triumphiert beim Thema Sozialdialog – Fragen zur Rentendebatte - 21. Januar 2025.
- „Skrupellos und ohne Mitgefühl“: Marianne Donven kündigt Posten als Staatsangestellte und verlässt „Conseil supérieur de la sécurité civile“ - 21. Januar 2025.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos