Luxemburg / „Der Baum brennt“: Das läuft schief an den Schulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
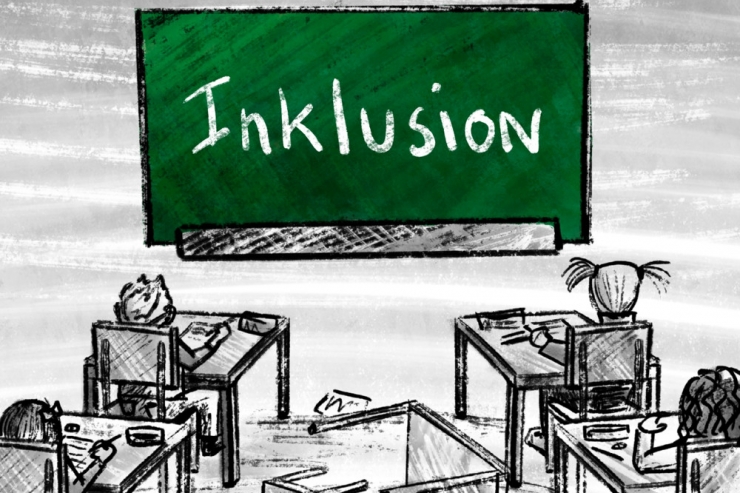
Vermeintliche Idylle: ein Luxemburger Klassenzimmer – doch der Schein trügt. Es fehlt an Lehrern und Erziehern für die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Die Zahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist regelrecht explodiert. Die Schulen sind überfordert, Kinder erhalten keine Hilfe und Lehrer brechen zusammen, sagt Joëlle Damé vom SEW. Das Tageblatt hat mit der Gewerkschaftlerin gesprochen und erfahren, wo es brennt.
Stellen Sie sich ein Kleinkind vor, das eingeschult wird. Tom, so der Name des fiktiven Schülers, ist ein verhaltensauffälliges Kind mit sozioemotionalem Förderbedarf. 2.574 Schüler wie Tom erhielten im vergangenen Schuljahr eine Hilfe des Unterstützungsteams für Schüler mit besonderem Förderbedarf (ESEB), wie aus einer Antwort von Bildungsminister Claude Meisch (DP) auf eine parlamentarische Frage hervorgeht. Fünf Jahre davor waren es noch 702 Schüler – eine rasante Entwicklung.
Die Zahlen drängen die Frage auf, wo der Anstieg herkommt. Das Tageblatt hat mit Joëlle Damé gesprochen, Präsidentin des Syndikats Erziehung und Wissenschaft (SEW) des OGBL und seit 1997 Grundschullehrerin in Petingen. Dabei ging es nicht nur um die Statistik, sondern auch um die Lage an Luxemburgs Schulen.
Was sind Schüler mit besonderem Förderbedarf?
Bildungsministerium: „Als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelten Kinder oder Jugendliche, die nach internationalen Klassifikationen Defizite oder Schwierigkeiten aufweisen bzw. deutlich größere Lernprobleme haben als die Mehrheit der gleichaltrigen Kinder oder Jugendlichen. Der sonderpädagogische Förderbedarf eines Schülers kann motorische, visuelle, sprachliche, auditive, intellektuelle oder sozioemotionale Bereiche betreffen.“
„Die Zahlen, die das Ministerium veröffentlicht hat, sind nicht vollständig“, sagt Damé: „Viele Kinder werden überhaupt nicht gemeldet.“ Außerdem würden die Kinder nicht erfasst werden, die auf den Wartelisten stehen. Grundsätzlich fehle es an zuverlässigen Daten in Luxemburg. „Wir führen keinen evidenzbasierten Diskurs“, sagt Damé. „Wir haben keine richtige Datenbank, das muss unbedingt gemacht werden.“ Sonst könne man die tatsächlichen Bedürfnisse überhaupt nicht kennen und auch nicht dementsprechend reagieren.
Und die „reellen Bedürfnisse“ sehen um einiges anders aus als auf dem Papier. Kommen wir zurück zu Tom. „Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, dem normalen Unterricht zu folgen, werden ihm an seine Bedürfnisse angepasste Fördermaßnahmen angeboten“, sagt das Bildungsministerium zu Fällen wie ihm. Doch wie sieht Toms Weg dahin aus und welche Maßnahmen kann er erhalten?
I-EBS, ESEB, CI, CNI – ein Abkürzungsdschungel
Verhaltensauffällige Kinder wie Tom machen das Gestalten eines regulären Unterrichts oft schwierig, sagt Damé. Zuerst werden die Möglichkeiten in der Schule erschöpft, um diese zu unterstützen – wenn sie diese hat. Dafür gibt es spezialisierte Lehrer für Schüler mit besonderem Förderbedarf (I-EBS), die vor Ort mit dem Kind zusammenarbeiten.
Glossar
Die Abkürzung I-EBS steht für „Instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques“. Die spezialisierten Lehrer unterstützen die betroffenen Schüler in ihrer Klasse.
ESEB steht für „Équipe de soutien des élèves à besoins spécifiques“. Die Erzieher unterstützen die Schüler und beraten die Eltern und die Lehrkräfte.
Die CI, „Commissions d’inclusion“, legen die Betreuungsmaßnahmen fest, die den Schülern angeboten werden.
Die letzte Instanz ist die „Commission nationale d’inclusion“, kurz CNI. Diese kann mit Anfragen nach einer spezialisierten Diagnose oder Betreuung kontaktiert werden.
Sollte Tom weitere Helfer benötigen, schaut sich das Lehrpersonal den Fall zusammen mit dem ESEB an. Das ESEB besteht in Petingen, wo Damé unterrichtet, aus drei Erziehern. Diese können Tom in der Klasse zur Seite stehen. Gleichzeitig sollen sie auch auf Krisen von einzelnen Kindern reagieren können. „Jedoch gibt es jetzt dermaßen viele Schwierigkeiten und Kinder mit besonderen Bedürfnissen, dass sie dazu übergegangen sind, ‚Workshops‘ mit mehreren Kindern zu machen“, sagt Damé. Die Erzieher können Tom wegen der schieren Anzahl an Fällen dann nicht mehr gerecht werden.
„Unbeschulbar“
Stuft das Lehrpersonal Tom trotz der Betreuung als „unbeschulbar“ ein, gibt es noch eine letzte Notfall-Reißleine. Dann wird ein sogenannter „Feuerwehrplan“ erstellt. Jede Stunde wird dann mit einer Person besetzt, die irgendwie Zeit hat, um sich um den Schüler zu kümmern. Aber diese Erzieher oder Lehrer fehlen natürlich an anderer Stelle. „Das ist keine Inklusion“, sagt Damé. Kurzfristig werden die Lehrer und die anderen Schüler entlastet, aber dem Kind selbst werde dabei nicht wirklich geholfen. „Das ist eine Anstrengung des Personals, strukturell ist nichts vorgesehen für Kinder, die das Unterrichten unmöglich machen.“
Die Grundschulen könnten diesen Kindern mit ihren begrenzten Ressourcen „absolut nicht gerecht werden“, sagt Damé. „Im Koalitionsvertrag der Regierung steht, dass die Anzahl an I-EBS auf zwei Stück pro Schule erhöht werden soll.“ In der Petinger Grundschule, in der Damé arbeitet, gab es etwa in den vergangenen Jahren gar keinen I-EBS. Dabei seien diese Lehrer enorm wichtig, weil sie die Schule, die Lehrer und die Kinder kennen. Und das reguläre Lehrpersonal sei oft am Ende seiner Kräfte. „Es gibt sehr viele, die krankgemeldet sind, die es nicht mehr schaffen und zusammenbrechen.“ Andere würden sich trotz der Belastung jeden Tag in die Schule „schleppen“.
Erste Hürde: Antrag stellen

Der nächste Schritt für einen Fall wie Tom ist die Eröffnung einer Akte. Dafür muss sich das Lehrpersonal an die Inklusionskommission (CI) wenden, die sich in den Regionaldirektionen befinden. Zuerst entsendet die Kommission Beobachter, um das betroffene Kind zu beurteilen.
Joëlle Damé kritisiert diese Vorgehensweise: „Wenn bei uns der Baum brennt und wir uns deswegen an die CI wenden, ist es meistens schon schlimm genug.“ Trotzdem würde dann zuerst entschieden werden, ob nicht vor Ort etwas unternommen werden könne. „Diese Möglichkeiten sind aber meistens erschöpft, sonst würde man sich nicht an die CI wenden.“ In der CI werde dann letztendlich entschieden, welche Maßnahmen angewendet werden. „Was meistens nicht viel ist, weil wir keine Mittel haben“, sagt Damé. Im individualisierten Betreuungsplan wird festgelegt, welche Unterstützung Tom erhält. Diese können von einer Anpassung beim Unterricht in der Klasse bis hin zu Workshops und eine ambulante Betreuung reichen.
„An sich sind die CI überhaupt keine dumme Idee“, sagt Damé. Eine breitgefächerte, multidisziplinäre Mannschaft – Lehrer, Erzieher, Eltern – ist laut ihr der richtige Ansatz, um Lösungen für die Kinder zu finden. „Die Ressourcen kommen aber nicht hinterher.“ 37 Prozent des Lehrpersonals in den Grundschulen haben laut dem Bericht des „Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire“ bereits gezögert, einen Antrag zu stellen – weil sie das Verfahren als zu kompliziert und als wenig effizient empfinden. „Viele Lehrer tun sich die Prozedur nicht mehr an, weil sie wissen, dass nichts dabei herauskommt“, sagt Damé.
Kompetenzzentren „maßlos überlaufen“
Die letzte Instanz auf Toms Weg ist die nationale Inklusionskommission (CNI). Die CNI bildet das Scharnier zu den Kompetenzzentren und entscheidet über eine spezialisierte Diagnose oder Betreuung. Es werde oft eine Beratung oder Begleitung für das zuständige Lehrpersonal angeboten – statt Hilfe für die Kinder. „Dann hat man zwölf, 13 oder 14 Monate auf eine Hilfe gewartet und kriegt als Lösung ein Coaching angeboten“, sagt Damé.
Wenn konkrete Empfehlungen ausgesprochen werden, seien diese manchmal nicht mal umsetzbar. „Diese Leute arbeiten nicht in der Schule, sie sehen die Situation mit ihrem fachlichen Blick, vergessen aber, dass in der Klasse noch 18 andere Schüler sitzen – vielleicht auch mit speziellen Bedürfnissen“, sagt Damé.
Sehr gravierende Fälle erfordern die Unterstützung eines Kompetenzzentrums wie des Zentrums für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen, des Logopädischen Zentrums oder – wie in Toms Fall – des Zentrums für sozioemotionale Entwicklung.
Die Kompetenzzentren bieten unterschiedliche Maßnahmen für die Kinder an. Im Zentrum für sozioemotionale Entwicklung kann Tom eine „spezialisierte Beschulung“ erhalten. Diese bereitet Tom auf eine Wiedereingliederung in die Regelschule vor. „Dort wird zum großen Teil therapeutisch gearbeitet“, sagt Damé. Tom kann dort wieder ein sicheres Umfeld erleben und Bindungen aufbauen. Nach zwei Jahren muss er dann wieder in eine reguläre Klasse zurückkehren.
Die Kompetenzzentren seien „maßlos überlaufen“. „Die Leute in den Zentren haben mir von Listen mit über 200 Fällen erzählt“, sagt Damé. Genaue Zahlen würde man aber auch hier nicht erhalten. Und beim Personal in den Zentren gebe es „eine große Unzufriedenheit“. Die Zentren seien oft unterbesetzt und es sei schwer, Kandidaten für die offenen Stellen zu finden.
Integration scheitert an Ressourcen
Die verschiedenen Akteure in diesem Prozess seien „sehr, sehr schwerfällig“, sagt Damé. Meistens würden die Lehrer in dem Schuljahr, in dem sie das Kind gemeldet haben, keine Hilfe erhalten. „Und dann wird im nachfolgenden Schuljahr vielleicht nur eine Beratung oder Begleitung angeboten“, sagt die Präsidentin des SEW.
Heute gibt es kaum eine Klasse, in der nicht ein Schüler mit besonderem Förderbedarf sitzt – und in der Regel ist es auch mehr als ein KindPräsidentin SEW
„Heute gibt es kaum eine Klasse, in der nicht ein Schüler mit besonderem Förderbedarf sitzt – und in der Regel ist es auch mehr als ein Kind“, sagt Damé. Die gewachsenen Zahlen der Kinder mit speziellen Bedürfnissen, die betreut werden, erklärt sie damit, dass vorher schlicht gar keine Ressourcen da waren, um die Schüler überhaupt zu betreuen. Die Kompetenzzentren in Luxemburg öffneten erst 2018 ihre Türen. Auch die ESEB seien noch nicht „ewig“ in den Schulen vorhanden. Die Ressourcen würden jedoch wachsen, und somit könnten auch mehr Kinder betreut werden. „Wir hinken aber immer noch hinterher.“
Die Integration in Luxemburg scheitere an den Ressourcen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schulen. Joëlle Damé: „Das Lehrpersonal läuft weg, in den Kompetenzzentren fehlt Personal – und den Kindern geht es schlecht.“
- Gemeinde Contern kündigt Mitarbeiter und enthebt OGBL-Delegierte ihres Dienstes - 17. Januar 2025.
- Staatsanwaltschaft räumt mit Gerüchten auf – im Lycée bleiben alle „bedrückt“ und „verunsichert“ - 10. Januar 2025.
- Wirtschaftsminister Delles plant Liberalisierung der Öffnungszeiten – Gewerkschaften wehren sich - 18. Dezember 2024.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos