Klangwelten / Großkotz und Tausendsassa: Die Welt und das Werk von Sufjan Stevens

Sufjan singt ohne autobiografische Gebaren von Ufo-Sichtungen, Massenmördern, Bürgerkriegen, Schriftstellern und Witwen.
20 Jahre nach seinem Debut veröffentlicht Sufjan Stevens in Zusammenarbeit mit seinem Stiefvater Lowell Brams „Aporia“. Die Hommage an New-Age-Musik klingt wie ein Soundtrack zu einem nicht existierenden Film, der sich trotz einiger starker Songs erst als Gesamtwerk erschließt. Im Rahmen dieser Neuerscheinung blicken wir auf die vielseitige Karriere eines musikalischen Tausendsassas zurück.
Großkotziger geht’s wohl kaum: Als Sufjan Stevens mit den beiden Platten „Michigan“ (2003) und „Illinois“ (2005) eine musikalische Anthropologie aller 50 amerikanischen Bundesstaaten antrat, werden sogar Megalomanen wie Muse-Sänger Matthew Bellamy mit den Augen gerollt haben.
Auf den beiden Platten festigte Sufjan Stevens seinen Status als Amerikas nächstes Singer-Songwriter-Talent. Im Gegensatz zu anderen Genre-Vertretern ging es Sufjan aber nicht darum, das eigene Leid in traurigen, akustischen Nummern zu besingen – seine Kartografie vom Michigan und Illinois umriss lokale Figuren und Mythen, Sufjan sang ohne autobiografische Gebaren von Ufo-Sichtungen, einem Massenmörder im Clownkostüm, Bürgerkriegen, Schriftstellern und Witwen.
Die Überlänge der beiden Alben spiegelte sich in den meisten Songtiteln wider, die Tracks klangen exzentrisch, warmherzig und wurden von Stevens Falsett und seinen empathischen Texten getragen. So opulent die Songs, so weitreichend auch die Themen: Die Platten erwähnten das amerikanische Hinterland, die Indigenen, urbanen Zerfall und Armut – auf „Michigan“ wurde er zum Sprachrohr jener, die in der amerikanischen Geschichtsschreibung bewusst an den Rand des Vergessens gedrängt wurden. Widmungen – „For The Unemployed And Underpaid“, „For The Widows In Paradise, For The Fatherless In Ypsilanti“, „For The Homeless In Muskegon“, „For Yia-Yia & Pappou“ – wurden konsequent in die Songtitel eingemeißelt und klingen auch heute noch wie empathische Verse einer schonungslosen poetischen Kartografie.
Musikalische Kartografie
Dass Sufjan Stevens auf diesen überlangen, verspielten Platten dann auch noch über 20 Instrumente spielte – darunter Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Oboe, Akkordeon, Vibrafon und das für seine Songs unumgängliche Banjo –, war dann irgendwie nur konsequent. Auf seinem eklektischen Debüt „A Sun Came“ (2000) hatte Stevens bereits bewiesen, wie vielseitig seine Musik sein würde. Jedem, der ihn danach als das neue Wunderkind von schiefem Folk und Schlafzimmer-Indie-Rock beschrieb, zeigte er mit der sperrigen Avantgarde-Elektro-Platte „Enjoy Your Rabbit“ (2001), dass konventionelle Genre-Zuweisungen bei ihm nicht funktionieren würden: Gerade, wenn man dachte, Sufjan Stevens Musik erfasst zu haben, war der Musiker bereits ganz woanders.
Irgendwann muss ihn die Mischung aus orchestralem Kammerpop – man höre dazu die zeitlosen Meisterwerke „Chicago“ oder „Come On! Feel The Illinoise!“ – und akustischen Tracks – siehe „John Wayne Gacy Jr.“, „For The Widows In Paradise, For The Fatherless In Ypsilanti“ – gelangweilt haben. Anders kann man sich das darauffolgende „Age Of Adz“ (2010) nicht erklären: Hier bettete Sufjan Stevens seine nach wie vor intimen Kompositionen und organischen Klänge in sperrige, unterkühlte Elektronik.
Das intime Meisterwerk
Die wilde Mischung aus Folk, Avantgarde-Elektronik und orchestralem Pop war jederzeit spannend, weckte Erinnerungen an Radioheads wagemutiges „Kid A“ und kulminierte im fast 26-minütigen „Impossible Soul“ – ein vertracktes, ungebändigtes Biest von einem Song, der orchestralen Indierock, kitschige Chöre, trashigen Elektropop, befremdendes Autotune und einen akustischen Epilog mühelos miteinander verband. Wer Jahre später dachte, Hipster Justin Vernon hätte mit seinem dritten Bon-Iver-Album das Rad neu erfunden, hatte bei „Age Of Adz“ nicht richtig hingehört – hier findet man bereits alle charakteristischen Stilelemente, bei denen sich Vernon für seine „Neuerfindung“ bediente.
Als man ihn irgendwann fragte, wo denn nun die restlichen 48 Bundesstaatsalben verbleiben würden, meinte Sufjan nur lakonisch, es habe sich dabei um einen PR-Gag gehandelt – und veröffentlichte 2015 „Carrie & Lowell“, sein bisher letztes reguläres Album, das an seine akustische Platte „Seven Swans“ (2004) erinnert und auf dem er den Tod seiner Mutter Carrie verarbeitet.
Carrie war drogenabhängig, alkoholsüchtig, psychisch krank und verließ ihre Familie, als Sufjan gerade mal ein Jahr alt war. „When I was three, three maybe four/She left us at that video store“, singt Stevens auf „Should Have Known Better“ – und gerade, weil nichts an diesem Meisterwerk weinerlich klingt, berühren einen diese Songs, in denen Stevens nicht nur das Leben der Mutter, sondern auch die Angst vor ihrem psychischen Erbe und den Genen thematisiert, so sehr.
Das Autobiografische transzendieren
Diese sehr intimen Songs, die teilweise auf einem iPhone in einem Hotel im Oregon aufgenommen wurden, sind zeitlos, weil es jedem einzelnen davon gelingt, die plakative Nabelschau zu vermeiden und das Autobiografische zu transzendieren: Seit jeher sucht Stevens das Universale in den einzelnen Schicksalen – nur singt er diesmal nicht über das Leben der anderen, sondern von seiner Familie.
Wer sich wundert, wo die Opulenz der Vorgängerplatten hin ist, muss einfach genauer hinhören – in „Carrie & Lowell“ steckt der Teufel im Detail, die Platte begnügt sich keineswegs mit Elliot-Smith-artigem Fingerpicking und akustischen Gitarren, im Hintergrund gibt es immer wieder elektronische Intermezzi, Klaviere, Orgeln und delikate Synthies, die die Leere tapezieren und dem Album einen warmen Klang verleihen. „Carrie & Lowell“ ist (neben „Illinois“) nicht nur Stevens’ definitives Meisterwerk – es ist auch die Schlüsselplatte, in der die Stilrichtungen der vorigen Arbeiten zusammenlaufen und die jede darauffolgende Veröffentlichung beeinflusst hat.
Die lange Wartezeit zwischen den regulären Studioalben kann der Sufjan-Stevens-Fan mit den zahlreichen Nebenprojekten verbringen. Von Filmsoundtracks (er steuerte drei wunderbare Songs zu Luca Guadagninos „Call Me By Your Name“ bei) über Musik für Ballett, Zusammenarbeiten mit The National („Planetarium“), Son Lux und Serengeti („Sisyphus“), Mixtapes („The Greatest Gift“), Live-Platten (das grandiose „Carrie & Lowell Live“), vereinzelten Singles (das tolle „Tonya Harding“) bis hin zu sehr ausführlichen Weihnachtssong-Sammlungen („Silver & Gold“) hat sich Stevens an fast alle Formate herangewagt. Jede dieser Arbeiten hat ihre Spuren im Hauptwerk hinterlassen. Seit der Veröffentlichung von „Carrie & Lowell“ kreisen diese Nebenveröffentlichungen jedoch wie Satelliten um sein akustisches Meisterwerk aus dem Jahr 2015.
Ein weiteres Puzzleteil
„Aporia“ bietet nun fünf Jahre später ein weiteres Puzzleteil seiner Familiengeschichte aus. Lowell Brams, mit dem er die Platte geschrieben hat, war fünf Jahre lang mit Sufjans Mutter verheiratet. Er ist der Mitbegründer von Sufjans Label „Asthmatic Kitty“. „Aporia“ ist die zweite Zusammenarbeit zwischen den beiden und markiert den Höhepunkt einer künstlerischen Zusammenarbeit – Brams verlässt das Label und geht in den Ruhestand. Die fünf Sommer, die Sufjan als Kind mit dem Stiefvater im Oregon verbracht hat, zählen zu den schöneren Kindheitserinnerungen des Musikers – sie sind es, die „Carrie & Lowell“ trotz aller Trauer zu einer lichtdurchfluteten Platte machen.
„Aporia“ versteht sich als Hommage an New-Age-Musik und klingt wie das instrumentale Pendant zu „Planetarium“ (2017). Die Platte besteht aus 21 Stücken, die sich trotz ihres fragmentären Charakters wie ein kohärenter Soundtrack zu einem nicht existierenden Science-Fiction-Film anhören. Stevens zitiert Referenzen wie Boards of Canada und den „Blade Runner“-Soundtrack, man denkt aber auch an die rezenten Arbeiten von 65daysofstatic für das Videospiel „No Man’s Sky“ oder den Sci-Fi-Klassiker „Silent Running“. Bei verschiedenen Tracks – vor allem in der Mitte der Platte – ist die Atmosphäre wichtiger als das Songwriting, das schöne „What It Takes“, das bedrohliche „The Red Desert“, das atmosphärische „Misology“ oder das vorab veröffentlichte „The Unlimited“ funktionieren aber auch als eigenständige Songs. „The Runaround“ ist das definitive Highlight von „Aporia“ – wenn nach einer halben Stunde Laufzeit zum ersten (und einzigen) Mal Sufjans leicht verzerrte Stimme einsetzt, um eine seiner wunderbaren Melodien erklingen zu lassen, merkt man, dass „Aporia“ trotz seiner vieler Qualitäten vor allem wieder Lust auf ein „richtiges“ Sufjan-Album macht.
Die Platten in der Übersicht (Auswahl)
- Barbie, Joe und Wladimir: Wie eine Friedensbotschaft ordentlich nach hinten losging - 14. August 2023.
- Des débuts bruitistes et dansants: la première semaine des „Congés annulés“ - 9. August 2023.
- Stimmen im Klangteppich: Catherine Elsen über ihr Projekt „The Assembly“ und dessen Folgeprojekt „The Memory of Voice“ - 8. August 2023.





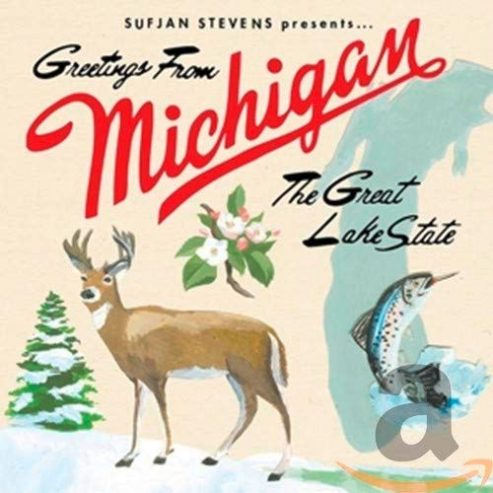

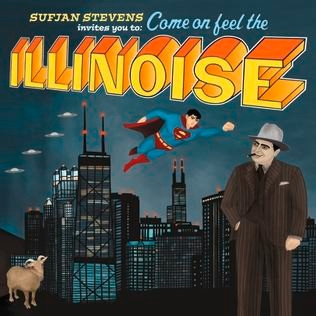
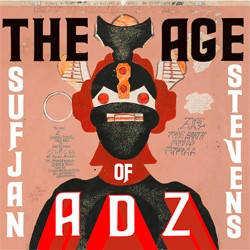


 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos