Literatur / Mit „The Treasury of Tales“ verschenkt Robert Schofield erzählerisches Potenzial

Mit seinem Roman „The Treasury of Tales“ war Robert Schofield einer der fünf Shortlist-Kandidaten des diesjährigen „Prix Servais“. Der Preis ging aber Ende April an Ulrike Bail für ihren Gedichtband „wie viele faden tief“.
Jacob und Wilhelm – so heißen die Hauptfiguren aus Robert Schofields Roman „The Treasury of Tales“. Märchenkennern dürften die Namen bekannt vorkommen: Sie lassen an die weltberühmten Brüder Jacob und Wilhelm Grimm denken, die als Geschichtensammler und Linguisten zu den Wegbereitern der modernen Germanistik gehören. Um Sprache und Erzählungen geht es demgemäß auch in Schofields Werk – doch der leicht verdauliche Roman hinterlässt letztlich keinen bleibenden Eindruck.
Der Roman „The Treasury of Tales“, der es auf die Shortlist des diesjährigen Servais-Preises schaffte, erzählt die Geschichte der Brüder Jacob und Wilhelm. Sie arbeiten zu Zeiten Napoleons am königlichen Hof in Kassel als Philologen. Wie das berühmte Geschwisterpaar Grimm, mit dem sie sich ihre Vornamen und Interessen teilen, setzen sie sich sowohl mit der deutschen Sprache und ihren regionalen Variationen als auch mit Märchen, Sagen und Legenden auseinander. Insofern erscheinen Jacob und Wilhelm, wie ihre reellen Vorbilder, als Sprachwissenschaftler und Volkskundler, die Pionierarbeit in Sachen Linguistik und Literaturgeschichte leisten. Die Handlung konzentriert sich jedoch nicht auf ihre Arbeit, sondern dreht sich um die Erlebnisse des jüngeren Bruders Wilhelm in Rabenheim, einer fiktiven Stadt weit weg von der Metropole des historischen Königreichs Westphalen. Dort soll der Gelehrte – ohne den Schutz und die Hilfe des erfahreneren Jacob – weitere Recherchen in der Bibliothek eines verlassenen Nonnenklosters betreiben.
Von größerem Interesse als die verstaubten Kräuterbücher in den Regalen der Abtei erweisen sich für den knapp 20-Jährigen aber die Erzählungen, die der Einheimische Thomas in der Dorfschenke zum Besten gibt. Dort lebt Wilhelm nämlich während seines Aufenthalts in Rabenheim – und lernt infolge Catherine Holzmer, die Ehefrau des Besitzers, und ihre Schwester Marie kennen. Mit Ersterer hat Wilhelm schon bald ein Techtelmechtel; zeitgleich geht er ein heimliches Bündnis mit Thomas ein, den er dazu überredet, ihm seine Geschichten bei vertraulichen Treffen zur Dokumentierung vorzutragen. Die beiden Männer werden schließlich Opfer eines Komplotts französischer Autoritäten, die auf der Suche nach dem klösterlichen Schatz sind, wobei der Rabenheimer Geschichtenerzähler zuvor schon selbst versuchte, Wilhelm hereinzulegen.
Verweise wecken Erwartungen
Mit den zahlreichen Referenzen auf das Philologen-Gespann Grimm bedient sich Schofield tragfähiger geschichtlicher Vorlagen. Die Idee, die Hauptfiguren nach dem Vorbild der Mitbegründer der Germanistik zu modellieren, ist nämlich insofern spannend, als sie zugleich die Tür zur Welt der Fabeln und Fantasiegeschichten, Mären und Märchen öffnet. Letztere dürften, zumindest in abgewandelter Form, den meisten Lesern aus frühester Kindheit bekannt sein. Dies ist ein Gewinn für den Autor, der – zumindest prinzipiell – den persönlichen Bezug des Rezipienten zu diesem kulturellen Fundus nutzbar machen kann, um ihn leichter in die dargestellte Welt eintauchen zu lassen. Von Interesse sind auch die Themen, die mit der zeitlichen Situierung der Handlung einhergehen. Immerhin ist die postrevolutionäre Herrschaftsperiode geprägt von sozialem Wandel, der sich unter anderem an dem Prestigeverlust des Adels ablesen lässt. Mit der Verschiebung von Reichsgrenzen stellen sich zudem Fragen nach kultureller Zugehörigkeit, Gemeinschaft und Identität. Schließlich lädt die thematische Fokussierung von „Treasury of Tales“ auf die Entstehung und Überlieferung von Erzählungen zu selbstreflexiven Aussagen ein, die das Werk und das Geschichtenerzählen an sich betreffen.
Angesichts des verheißungsvollen Charakters des vorliegenden Materials erscheint der Roman jedoch letztlich enttäuschend. Schofield arbeitet sich an dem Schicksal der zwei Figuren ab, ohne dass er dabei inhaltlich oder stilistisch in die Vollen greifen würde. Nüchtern und knapp beschreibt der Autor die Handlungsvorgänge, in einem erzähltechnischen Staccato handelt er Szene für Szene ab. Beim Leser hinterlässt diese Sprach- und Darstellungsökonomie einen Eindruck von Lieblosigkeit und erzählerischer Ungelenkigkeit. Richtig in die Erzählung einfinden kann er sich somit nicht. Schofield verschenkt das Potenzial, das dadurch gegeben ist, dass er das Leben und Schaffen zweier bekannter Persönlichkeiten fiktionalisiert. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei um Brüder handelt – eine Konstellation, die als Mythos bis zum biblischen Buch Genesis zurückreicht –, wäre es dem Autor ein Leichtes gewesen, den Roman durch eine ausführliche und psychologisch durchdachte Darstellung der geschwisterlichen Dynamik aufzuwerten.
Figuren bleiben Silhouetten
Zwar wird die Beziehung zwischen Jacob und Wilhelm immer wieder thematisiert, jedoch geschieht dies vornehmlich in einer lapidaren und erzählerisch linkischen „Tell, don’t show“-Manier. Will heißen: Treffen die beiden Figuren aufeinander, folgt schon nach einem flüchtigen Wortwechsel oder einer kurzen Interaktion die erzählerische Synthese, wie zum Beispiel: „,I’ll write to you about the effort,’ Wilhelm said. ‚And possibly about the gems.’ They smiled and became the pair again. ‚Come safely home,’ Wilhelm said, ‚and wish me luck.’“ Solche Aussagen machen das Verhältnis des Duos auf Beschreibungsebene explizit, ohne dass es durch das ausführlichere Zeigen ihres Umgangs miteinander glaubwürdig erschiene. Ähnliches gilt für die anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, die im Zentrum des Romans stehen. Sie haben trotz der Skizzierung von Konflikten nicht die Chance, sich als komplexe Geflechte zu entfalten – die Figuren erscheinen bis zuletzt holzschnittartig und schablonenhaft.
Über die oberflächliche Figurenzeichnung und das Dahintröpfeln des Plots hinaus lassen sich schließlich noch die melodramatischen und abwegig erscheinenden Wendungen, die sich besonders in den letzten Kapiteln des Buchs häufen, sowie der offene Schluss an sich kritisieren. Immerhin reißt die Handlung von „The Treasury of Tales“ nach der plötzlichen Ermordung von Holzmer und der Verhaftung von Marie, als Hexe verschrien, einfach ab. Man gewinnt den Eindruck, dass dies kein bewusster erzähltechnischer Schachzug ist, sondern zurückgeführt werden kann auf die Verlegenheit eines Autors, der nicht genau weiß, wie er die Erzählung abschließen soll. Er bleibt somit dem Leser einige Erklärungen schuldig. Summa summarum gräbt sich der Roman nicht tief ins Gedächtnis ein – er läuft Gefahr, an demselben Regalplatz zu enden wie die verstaubten Kräuterbücher der Rabenheimer Klosterbibliothek.
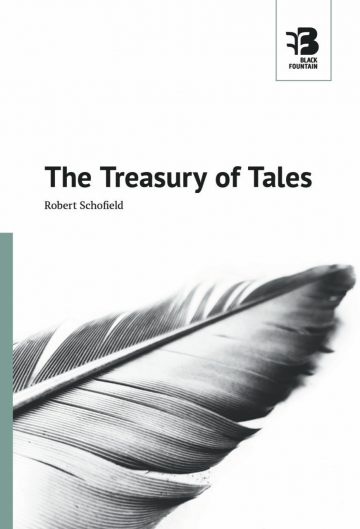
Lesen Sie auch:
Ulrike Bail gewinnt mit „wie viele faden tief“ den Prix Servais
- „und zerbröselt in vierzig stückchen illusion“: Tom Webers Lyrikband „fluides herz“ erzählt von Zerfall und Neubeginn - 19. Dezember 2022.
- Wir müssen die Lyrik befreien: Warum die Dichtung trotz ihrer Präsenz in den Medien ein Image-Problem hat – und wie sich das ändern kann - 27. November 2022.
- Mehr Akzeptanz fürs Kinderwunschlosglück: „Nichtmuttersein“ von Nadine Pungs - 4. September 2022.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos