Platte der Woche / „You are the singer, and I am the song“: „Memento Mori“ von Depeche Mode

Martin Gore (l.) und Dave Gahan mussten das neue Album „Memento Mori“ ohne den verstorbenen Andrew Fletcher aufnehmen
„Memento Mori“ wollte Andy Fletcher das 15. Depeche-Mode-Album nennen. Als das dritte Bandmitglied dann urplötzlich verstarb, standen Martin Gore und Dave Gahan schlagartig ohne den Schutzengel, der die beiden Zankhähne vor der Eskalation bewahrte, mit einer bereits halbfertigen Platte im Studio. Das Resultat ist ein starkes Album, das die 80er-Nostalgiewelle manchmal etwas zu offensichtlich reitet.
„Memento Mori“, das 15. Album der legendären Synthie-Rocker Depeche Mode, sorgte bereits vor seiner Veröffentlichung für mehr Aufmerksamkeit als seine beiden Vorgänger „Delta Machine“ (2013) und „Spirit“ (2017): Nachdem Andrew Flechter, dritter Mann im Bunde und „Schiedsrichter“ zwischen den beiden Streithähnen Dave Gahan und Martin Gore, urplötzlich verstarb, schien die Zukunft der Band mehr als ungewiss.
Denn seit Gahan mittels einiger Soloalben und dem Soulsavers-Projekt bewiesen hat, dass er selbst auch tolle Songs schreiben kann und Gore somit nicht mehr der alleinige Depeche-Mode-Songwriter ist, hat sich das Bandgefüge etwas demokratisiert: So gibt es seit „Playing the Angel“ (2005) auf jeder Platte einige von Gahan geschriebene Songs – so wie es seit der ersten Platte „Speak and Spell“ (1981), abgesehen von „A Broken Frame“ (1982), jedes Mal mindestens einen Track gibt, auf denen Gore die Lead-Vocals übernimmt.
Dieser Demokratisierungsprozess kam aber nicht ohne Spannungen bei den Aufnahmen – laut Produzent James Ford hatte sich die Band bei den Aufnahmen von „Spirit“ fast aufgelöst, wie wichtig Fletcher für das Gleichgewicht im Bandmikrokosmos war, zeigt sich in zahlreichen Bandinterviews, in denen Dave Gahan zugibt, Martin und er haben halt lernen müssen, „anders zu kommunizieren“, der Tod von Fletcher habe sie mit der „Aufgabe“ (!) konfrontiert, „Freunde zu werden“.
Als sie die Hiobsbotschaft erreichte, hatten Gore und Gahan bereits zahlreiche Demos zu den verschiedenen Songs hin- und hergeschickt. Erst überlegte man, ob man ohne Fletcher überhaupt weitermachen sollte. Aber da gab es diese Songs – und den Albumtitel, „Memento Mori“, den Fletcher ihnen vermacht hatte – und der nun irgendwie prophetisch klang.
Mit dem Tod setzt sich diese Platte dann auch auseinander, die zwar thematisch dunkler, dafür aber klanglich leichtfüßiger als seine beiden etwas schwerfälligen Vorgängerplatten ausfällt. Das liegt daran, dass sich „Memento Mori“ wieder stärker auf den Synthie-Pop der 80er fokussiert.
Ob das nun dem Zeitgeist – schließlich ist die Neuaufarbeitung der 80er in der zeitgenössischen Popmusik seit nunmehr fast zehn Jahren ein scheinbar unkaputtbarer Trend – oder der neuen Songwriter-Konstellationen geschuldet ist – für einige der eingängigsten Songs hat sich Martin Gore mit The-Psychedelic-Furs-Frontmann zusammengetan –, ist dabei im Endeffekt recht egal: „Ghosts Again“ ist seit „Precious“ die erste Bandsingle, die sofort zündet, das ebenso mit Butler komponierte „My Favourite Stranger“, dessen eingängige Melodie sich gegen sägende, entstellte Gitarren reibt, hätte auch auf „Playing the Angel“ fungieren können.
Mit „People Are Good“ und „Never Let Me Go“ (nach Placebo bereits die zweite Band, die den Titel von Kazuo Ishiguros grandiosem Roman zitiert) huldigen gleich zwei Songs augenzwinkernd der eigenen Bandvergangenheit – und das nicht nur im Songtitel: „People Are Good“ hat einen ähnlichen Beat wie „People Are People“, der Chorus von „Never Let Me Go“ ähnelt dem von „Never Let Me Down Again“ verdächtig.
Nostalgie und Todesengel

Dennoch sind die Songs keineswegs Kopien ihrer Hypotexte: „People Are Good“ kommt mit dunklen, wabernden Synthies daher, die nur dann im Kontrast zu den Lyrics stehen, wenn man nicht richtig hinhört – denn so positiv, wie der Songtitel es vermuten lässt, ist Gores Weltbild eben nicht: „Keep fooling myself/ That everyone cares/ And they’re all full of love/ It’s just their patience gets tried“. Und „Never Let Me Go“ ist eine erfreulich autonome New-Wave-Hymne zwischen Synthie-Nostalgie und preschenden E-Gitarren.
Nachdem Gahan und Gore auf „Spirit“ zum ersten Mal zusammen einen Song schrieben – was bei Bands wie Sonic Youth geschätzt zwei Tage benötigte, brauchte bei Depeche Mode also sage und schreibe 37 Jahre –, scheint auch dies, wie die Gahan-Songs seit 2005, im Inbegriff zu sein, eine Tradition zu werden: „Wagging Tongue“ steht diesmal prominent an zweiter Stelle, sollte laut Gahan anfangs eine Art Folk-Song werden, bis Gore Gahans Songskelett einen elektronischeren Einschlag gab.
Apropos Elektro: Die Synthies wirken auf vielen Tracks wie „Wagging Tongue“ weniger experimentell als so manches auf „Playing the Angel“ oder „Sounds of the Universe“ – die Band ist sich bewusst, wie trendig der in den 80ern von ihr maßgeblich mitentwickelte Sound wieder ist, sodass die filigranere Arbeit an den elektronischen Sounds, die einen Großteil der 2000er-Alben ausmachten, einem klareren, jedoch auch eintönigeren Klanggewand gewichen ist. So ist selbst das experimentellere Intro vom schönen Liebeslied „Always You“ trügerisch: Beginnt der Track mit vertrackten Beats und zeitgenössischen Elektro-Elementen, verwandelt er sich dann während Strophe und Refrain wieder in eine Hommage und Selbstreferenz an den New Wave der 80er.
Das steht so manchem Song gut zu Gesicht: Das tolle „Caroline’s Monkey“ zeigt, wie Nick Cave sich im Elektropop-Kontext schlagen würde und die Ballade „Don’t Say You Love Me“, die bereits vielerorts (zu Recht) mit Scott Walker verglichen wurde, klingt nach schaurigem Western und großen Gefühlen – während Dave Gahan mit diesem Sinn für Größenwahn, für das man ein Bariton wie seines benötigt, das Spiel der amourösen Binom-Metaphern spielt („If you play the sinner/ I’ll play the stain/[…] You’ll be the laughter – and I’ll be the punchline of course”), rollen sich arpeggierte, staubige Gitarren in die desillusionierende Leere nach der Liebe.
Andere Tracks hingegen erschöpfen sich dadurch aber auch recht schnell – das bereits erwähnte „Wagging Tongue“ hätte definitiv etwas vielschichtiger sein können, und auch die von Gore gesungene Ballade „Soul With Me“ fällt im Vergleich zu „Don’t Say You Love Me“ deutlich ab. „Before We Drown“ ist solide, hat man im Bandkontext aber zumindest so ähnlich schon gehört.
Umrahmt wird „Memento Mori“ von zwei seiner melancholischsten Songs: Opener „My Cosmos Is Mine“ besingt den Rückzug ins eigene Innenleben angesichts einer Welt, die uns seit drei Jahren mit regelmäßigen Schreckensmeldungen an das Limit des psychisch Ertragbaren bringt, der Harmoniewechsel in der Mitte des Tracks, dem Gores Gesang zu verdanken ist, bringt etwas Licht in diese von Sci-Fi-Synthies getragene Ouvertüre.
Der sehr intime Closer „Speak To Me“ erzählt von einer Nahtoderfahrung – Gahans lyrisches Ich liegt auf dem Flur des Badezimmers, seine Stimme hallt in die Leere, ist nur von flirrenden Synthies umgeben –, am Ende bleibt ein pochender Beat, der etwas plakativ, aber dennoch schön hoffnungsspendend einen Herzschlag mimt. Auch wenn es tragisch anmutet, dass es den Tod von Fletcher brauchte, um die seit zwei Alben etwas altersmüde Band wachzurütteln: Vitaler hat Depeche Mode lange nicht geklungen.
Das Spätwerk unter der Lupe
Fast überall liest man, „Memento Mori“ wäre das beste Depeche-Mode-Album seit „Ultra“. Die Strategie, die Qualität vergangener Werke zu schmälern, um für die Neuerscheinung zu werben, ist in PR-Texten gang und gäbe, wird aber mittlerweile auch gerne von (etwas arbeitsscheuen) Journalisten übernommen. Wir haben uns alle Platten seit dem Meisterwerk „Ultra“ (1997) noch mal angehört – und verraten, was das Spätwerk der „populärsten Elektronikband der Welt“ (laut der Zeitschrift Q) aus heutiger Sicht noch taugt.

Aufregend klingt „Dream On“, der Opener und die Lead-Single von „Exciter“ (2001), auch heute noch: Die bluesigen Gitarren, der Melodie-Bogen, der langsam in einen Chorus für die Ewigkeit mündet, die Beats und Synthies klingen auch 2023 kein bisschen veraltet und zeigen, dass Depeche Mode bei allem Stadion-Appeal die Begeisterung für Experimentierfreudigkeit und elektronische Soundtüftelei nie verloren hat. Weniger exciting ist aus heutiger Sicht leider der Rest der Platte, die sehr oft vor sich dahinplätschert. Schuld sind die vielen überlangen Mid-Tempo-Songs, die sofort nach den beiden starken ersten Tracks das Tempo ganz herausnehmen. Erst in der zweiten Hälfte wird die Platte mit „Freelove“ oder „I Feel Loved“ wieder spannender – da ganze vier Songs das Wort „Love“ im Titel beinhalten, fällt es zudem nicht leicht, sie auseinanderzuhalten.

„Playing the Angel“ (2005) ist nicht nur die erste Depeche-Mode-Platte, auf der Dave Gahan einen eigenen Song beigesteuert hat (und was für einen: „Nothing’s Impossible“ ist einer der besten Tracks einer starken Platte), sondern vielleicht auch das Depeche-Mode-Album, an denen sich alle darauffolgenden Alben messen mussten. Wer fand, „Exciter“ sei zu seicht gewesen, wird mit den krachigen Klängen des Openers „A Pain That I’m Used To“ wachgerüttelt: „Playing the Angel“ pendelt zwischen Industrial, der streckenweise an NIN erinnert, tollem Elektroblues („John the Revelator“) und melancholischen Liebesballaden („Suffer Well“), bietet mit „Precious“ eine der besten Singles der späten Bandgeschichte und ist die einzige Depeche-Mode-Platte dieses Jahrtausends, die man noch heute vom ersten bis zum letzten Track hören sollte.

„Sounds of the Universe“ (2009) hält das hohe Niveau seines Vorgängers: Die Songs sind durch die Bank toll, Lead-Single „Wrong“ kombiniert effizient verträumte Elektronik mit Gospel, Soul und Blues und ergänzt die Bandformel noch mal um neuartige Sounds. Anderswo geht es klassischer, aber effizient zu („In Chains“), die Gahan-Songs, oftmals bluesiger und rockiger („Hole to Feed“, „Come Back“), ergänzen Gores verträumte, perfekt geschliffene Elektropopkleinoden („Fragile Tension“) und seine leicht dissonanten Balladen, die von seinen Soloerfahrungen auf „Counterfeit“ zeugen („Little Soul“). Im Vergleich zu „Playing the Angel“ ist die Platte einen Tick weniger facettenreich und das Songwriting fällt speziell gegen Ende etwas ab, dafür sorgt das Gleichgewicht zwischen eleganter Gitarrenarbeit, Avantgarde-Elektro und Pop-Appeal auf Tracks wie „Peace“ oder „In Sympathy“ für einen wahren Hörgenuss.
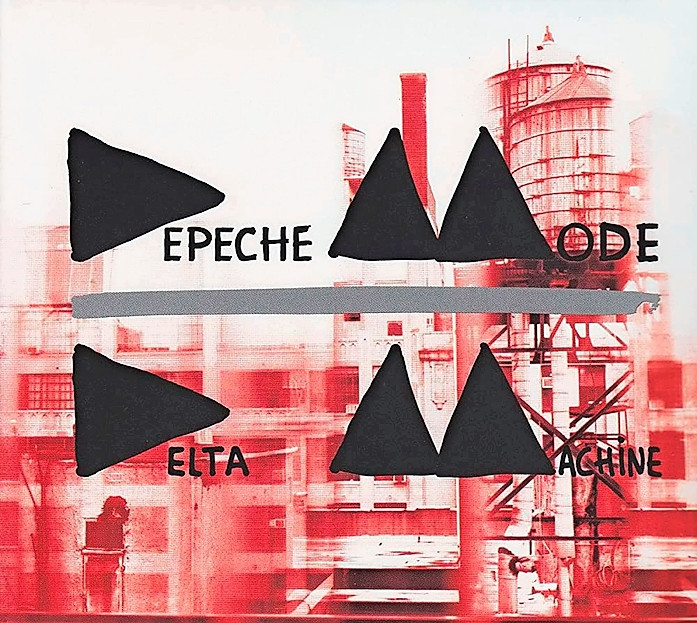
„Delta Machine“ (2013) ist definitiv keine schlechte Platte – zu sowas ist Depeche Mode nicht wirklich fähig –, fällt aber im Vergleich zu den beiden starken Vorgängerplatten etwas ab, was sich bereits an der im Vergleich zu „Precious“ und „Wrong“ etwas schwächelnden Lead-Single „Heaven“ erahnen ließ: Der Song reiht sich, wie u.a. auch „Soothe My Soul“ oder „Goodbye“, in die Reihe unzähliger solider Elektro-Blues-Songs ein, die Depeche Mode seit „Personal Jesus“ perfektioniert hat, wirkt aber deswegen weniger zwingend als die Vorgänger. Mit „Soft Touch/Raw Nerve“ knüpft die Band an poppige Großtaten aus den 80ern an, auf der ersten Albumhälfte gibt es zudem mit „Secret to the End“ und „My Little World“ ein paar Songs, die sich aus der Komfortzone heraustrauen. So bietet Depeche Mode mit „Delta Machine“ eine durchaus solide, aber etwas abwechslungsarme Songsammlung, die weniger experimentierfreudig als seine beiden Vorgänger ausfällt: Die Maschine hier ist gut geölt, aber etwas routiniert.

Ein ähnliches „Spirit“ (2017) herrscht auf dem Nachfolgealbum: Auch hier gibt es vorwiegend Midtempo-Blues, wovon bereits das (ziemlich tolle) erste Albumdrittel zeugt – „We’re Going Backwards“ klingt klanglich weniger retrograd als die im Song besungene Gesellschaft, dafür ist das schöne „Where’s the Revolution“ weniger aufmüpfig, als es der Titel andeutet. Dass sich hier mit „You Move“ der erste von Gahan und Gore zusammen komponierte Song befindet, ist eigentlich die wahre Revolution, selbst wenn der Song selbst eher konventionell-dunkel ausfällt. Trotz Songnamen wie „The Worst Crime“, „Scum“ ist „Spirit“ eine der gemächlichsten Depeche-Mode-Platten, deren Homogenität immer dann gefällt, wenn das Songwriting stimmt. Trotz aller Liebe zum Detail, vorzüglich-bedrohlicher Stimmung und gutem Songwriting hat „Spirit“ ein paar langsame Balladen („Cover“ oder „Eternal“) oder Elektroblues-Nummern („Poison Heart“) zu viel.
- Barbie, Joe und Wladimir: Wie eine Friedensbotschaft ordentlich nach hinten losging - 14. August 2023.
- Des débuts bruitistes et dansants: la première semaine des „Congés annulés“ - 9. August 2023.
- Stimmen im Klangteppich: Catherine Elsen über ihr Projekt „The Assembly“ und dessen Folgeprojekt „The Memory of Voice“ - 8. August 2023.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos