Buch / Ein Klassenflüchtling erinnert sich an seine Mutter: „Tu verras, tu seras bien“*

In dem Buch „Eine Arbeiterin“ über die eigene Mutter streift Didier Eribon die Missstände in französischen Pflegeheimen, verurteilt die einfache Herkunft seiner Mutter und landet doch immer wieder bei sich selbst.
Das Buch trägt den bedeutungsvollen Titel „Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben“. Nach Annie Ernaux („Eine Frau“) und Édouard Louis („Die Freiheit einer Frau“) hat nun auch Didier Eribon ein Buch über seine Mutter geschrieben, das angesichts der Skandale 2022 über Hygienemängel und den Personalmangel in staatlichen französischen Pflegeheimen eine traurige Aktualität erfahren hat.
Angesichts des Zusammenhalts der literarischen Clique (Eribon, Ernaux, Louis), die schreibend aus dem Arbeitermilieu ausgebrochen ist und sich – nicht ohne das Naserümpfen der französischen Eliten – regelrecht hochgeschrieben hat, weckt diese Serie an Büchern über ihre Mütter Neugierde. Doch was können diese einstigen Außenseiter:innen des französischen Literaturbetriebs dem klugen Essay Simone de Beauvoirs über „Das Alter“ (1972) heute noch hinzufügen?
Wiederholungseffekt
Eribon, der bereits mit „Rückkehr nach Reims“ (2009) Soziologiedoyen Bourdieu auf den Sockel gehoben hat, liefert mit „Eine Arbeiterin“ leider nicht viel Neues. Bereits auf den ersten 100 Seiten stellt sich das Gefühl des Wiederholungseffekts ein, meint man, seine allgemeinen Betrachtungen über den Bruch mit der eigenen Herkunft schonmal gelesen zu haben. Zudem stellt er direkt im ersten Satz klar, dass er seine Mutter in dem Pflegeheim kaum besucht hat: „Am Ende bin ich also nur zwei Mal in Fismes gewesen.“ Begründungen dafür liefert Eribon zahlreiche. Als da wären die weite Distanz zu Paris, die vielen Lesungen und wichtigen Projekte mit Regisseuren wie Thomas Ostermeier (eine zweifellos eindrucksvolle Inszenierung seines Romans auf der Berliner Schaubühne, 2020!).
Die Entscheidung, die Wohnung seiner Mutter aufzugeben und ihren Umzug ins Pflegeheim, begreift er als schicksalhaftes Ergebnis ihres gesellschaftlich determinierten Lebens. Der Autor ist sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst: „Es ist eine endgültige Entscheidung. Das ist der Ort, an dem man sterben wird.“
Wieder hat Eribon umfangreiche Quellen gewälzt. Die Querverweise und zahlreichen Fußnoten zeugen von einer sorgfältigen intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Alter, dem Älterwerden und schließlich der Unausweichlichkeit des Todes: „Die Gespräche mit meiner Mutter machten mir deutlich, dass Alter und körperliche Gebrechlichkeit diesen Kontext darstellt – eine Fessel, ein ‚Gefängnis‘ –, der die Möglichkeit, seinem Schicksal, und sei es mit letzter Kraft, zu entfliehen, zunichtemacht: Man will vielleicht, aber man kann nicht mehr. Und weil man nicht mehr kann, will man auch irgendwann auch nicht mehr.“
Sie sei zur „Unfreiheit“ verdammt gewesen, stellt er fest. Bereits der Rekurs auf eine japanische Erzählung „Die Narayama-Lieder“, eine Allegorie der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Absonderung alter Menschen, die sich gebrechlich auf einen Berg tragen lassen, um dort auf den Tod zu warten, lässt den Vergleich zu den Verhältnissen in dem staatlichen französischen Pflegeheim vermuten: „In dieser Konstellation ist das EHPAD in Fismes der Berg Narayama, und meine Mutter verkörpert nacheinander oder gleichzeitig die verschiedenen Reaktionen der alten Menschen (Ablehnung und Protest; Akzeptanz; Resignation und Unterordnung), […]“ Norbert Elias zitierend übernimmt er dessen Feststellung: „Viele Altersheime sind Einöden der Einsamkeit.“
Die Zustände und Qualen, die seine Mutter im „Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes“ (EHPAD) in Fismes erfährt, begreift Eribon als pars pro toto: „Das EHPAD in Fismes war keine Pflegeeinrichtung für das Bürgertum, und die Männer und Frauen, die dort lebten, hatten keinen bürgerlichen Hintergrund, sondern entstammten derselben Schicht wie meine Mutter […]“
Doch streift der Autor die Missstände in dem staatlichen französischen Pflegeheim EHPAD, Bezug nehmend auf das Buch von Anne-Sophie Pelletier „EHPAD, une honte française“ (2020), die von „schweren Verletzungen der Grundrechte alter Menschen“ spricht und das System als „unmoralisch“ an den Pranger stellt, nur. So schildert Eribon etwa, wie seine Mutter ihn anfangs anrief, um sich bei ihrem Sohn über die Zustände im Heim zu beschweren: „Sie erzählte, man habe ihr verboten aufzustehen, sie dürfe nicht duschen, niemand käme, wenn sie klingelt.“
Bevor sich der Autor in allgemeinen Betrachtungen über seine Herkunft verliert, wird er zum Ende des vierten Kapitels deutlich: „Meine Mutter erlebte nicht nur den Verlust ihrer Freiheit, vielleicht sogar ihrer Menschenwürde. Das ist genau das Problem in solchen Einrichtungen: die Entmenschlichung der alten Menschen.“
Die zahlreichen Referenzen auf Édouard Louis und Annie Ernaux nerven ein wenig, etwa, wenn Eribon über das Buch seines Freundes Louis einräumt: „Auf Französisch trägt das Buch von Louis den Titel ,Combats et métarmorphoses d’une femme‘ […] Treffender könnte man es nicht ausdrücken.“
Mit Verweis auf Bert Brechts „Die unwürdige Greisin“ schildert Eribon, wie seine Mutter nach dem Tod seines Vaters durch eine neue Liebschaft für einen winzigen Zeitraum die Freiheit entdeckte. „Kurz gesagt: Sie erlebte kurze Jahre der Freiheit nach langen Jahren der Knechtschaft.“ Doch mit dem Ende dieser Liebschaft erlosch nach der Wahrnehmung ihres Sohnes auch ihr Lebenswille.
Immer wieder reduziert Eribon seine Mutter auf ihre Klassenzugehörigkeit als einfache Arbeiterin, ihren Rassismus und ihren Dialekt
Obsessiver Rassismus
Immer wieder reduziert Eribon seine Mutter auf ihre Klassenzugehörigkeit als einfache Arbeiterin, ihren Rassismus und ihren Dialekt: „Als Beschäftigte der Glasfabrik Verreries mécaniques champenoises musste sie lernen, wie man sich als Arbeiterin verhält, musste einem Schichtplan folgen, sich an die geltenden Regeln und Vorschriften halten, alle Arbeiten erledigen, die man ihr auftrug, sich an den Rhythmus des Fließbandes gewöhnen, an dem sie täglich acht Stunden stand; […].“
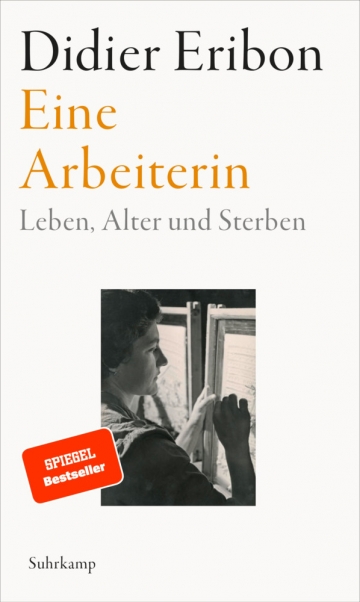
Er beschreibt, wie seine Mutter oft den ganzen Tag vor dem Fernseher saß, der von morgens bis abends in ohrenbetäubender Lautstärke lief. Das Fernsehen wurde für sie nicht nur „ihre einzige Zerstreuung“, sondern auch „ihre einzige Beschäftigung“ und wie ihre Freundinnen hatte sie die Angewohnheit, die Bilder lautstark zu kommentieren.
Ihr obsessiver Rassismus konsternierte den Sohn. So gibt Eribon vor, dass ihre despektierlichen Äußerungen über „die Nordafrikaner“, „die Schwarzen“ und „die Chinesen“ einer der Gründe war, warum er sie nicht mehr besuchte. In ihren rassistischen Äußerungen unterschritt sie regelmäßig ein Niveau, das zu tolerieren er nicht bereit war, wie „das Hintergrundrauschen des Fernsehers war dies ein Ärgernis, das ich während der gemeinsamen Zeit mit meiner Mutter ertragen musste“. Erklärungsmuster dafür findet er meistens bei Bourdieu, der dies als „Verstetigung sozialer Gewalt“ bezeichnete. Aus seiner Ablehnung der eigenen Familie macht er keinen Hehl, etwa, wenn er über seinen Bruder berichtet, dass dieser von Sozialhilfe in Belgien lebe. Was geht dieses öffentliche Outing seine Leserschaft an?
Nur selten kommen von dem sich kokettierend als „Klassenflüchtling“ bezeichnenden Autor liebevolle Erinnerungen an seine Mutter hoch, etwa, wenn er anerkennend einräumt, dass sich ihre genealogischen Kenntnisse über mehrere Generationen erstreckten und er wehmütig zu dem Schluss kommt: „Die Archivarin und Historikerin meiner Jugend ist nicht mehr da, um mir davon zu erzählen.“
Selbstkritisch räumt er an einer Stelle ein: „Im Grunde weiß man sehr wenig über die eigenen Eltern. Ich wusste kaum etwas über die Gegenwart meiner Mutter jenseits der Stunden, die sie zu Hause mit der Familie verbrachte, und noch weniger über ihre Vergangenheit, ihr Leben vor der Hochzeit und den Kindern (dasselbe könnte ich von meinem Vater sagen).“ Vielleicht ist dies die ehrlichste Passage. Dennoch ist sich Eribon sicher: „Meine Mutter war ihr Leben lang unglücklich.“
Die vielen Rückbezüge auf Bourdieu, auf dessen Beerdigung er eingeladen war und dieser auch beiwohnte, entlarven in erster Linie seine Eitelkeit. Es bleibt dabei: in dem trostlosen Pflegeheim in Fismes hat er sie nur zweimal besucht. Auf der Beerdigung seiner eigenen Mutter war er nicht, ihren Tod erklärt er zum „Nicht-Ereignis“.
So stellt sich der Eindruck ein, dass der Tod und die Herkunft der eigenen Mutter als Vorwand dient, um sich selbst zu analysieren und letztlich zu profilieren. Und es bleibt ein diffuses Unbehagen darüber zurück, dass Eribon seine Mutter nicht wirklich kannte.
* Das Zitat ist von Jean Ferrat, einem Liedermacher der Arbeiterklasse, der der Kommunistischen Partei nahestand.
Buch
Didier Eribon: „Eine Arbeiterin. Leben, Alter, Sterben“, 272 Seiten, Suhrkamp Verlag 2024. 25 Euro (D).
- Sandy Artuso macht mit „Queer Little Lies“ Esch zum queeren Kultur-Hotspot - 26. November 2024.
- Gewerkschaften und Grüne kritisieren „Angriffe der Regierung“ auf Luxemburgs Sozialmodell - 26. November 2024.
- Sozialwohnungen statt Leerstand: Was die „Gestion locative sociale“ Eigentümern bieten kann - 26. November 2024.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos