Essay / „I’m not here, this isn’t happening“: „Kid A“, „Black Market Music“ und „Hybrid Theory“ werden 20

Radiohead-Sänger Thom Yorke
Während man in England Künstlern und Musikern einen Kurswechsel empfehlt, feiern drei Kultplatten ihren 20. Geburtstag. Man kann die Gelegenheit für eine nostalgische Zeitreise in den musikalisch hochproduktiven Oktober 2000 nutzen – oder man denkt darüber nach, ob angesichts der aktuellen Produktionsbedingungen musikalische Innovationen wie Radioheads „Kid A“ heute überhaupt noch möglich sind.
Jeder wird es kopfnickend bestätigen: Ohne Kultur hätten wir den Lockdown nicht überstanden. Ohne Kultur würden wir die vielleicht wieder bevorstehenden Ausgangsbeschränkungen damit verbringen, uns mit Partnern oder entfremdeten Familienangehörigen zu zanken. Im einsamen Frühjahr wurde bis zur Server-Überhitzung gestreamt, wir haben virtuelle Serienlisten abgehakt, endlich ein paar Klassiker (oder einfach nur Camus’ „Pest“) gelesen, haben abends bei Rotwein melancholische Bands gehört, um den passenden Soundtrack zum heraufbeschworenen Weltuntergang maßzuschneidern.
Dieser Konsens hat eine Schattenseite: Wegen der bevorstehenden Wirtschaftskrise scheint niemand bereit zu sein, den Zuschuss an Geld für Kulturproduktionen, der sich aus diesem Zugeständnis der kulturellen Notwendigkeit eigentlich ableiten ließe, zu bewilligen. Der englische Schatzkanzler Rishi Sunak rät Musikern gar, die Branche zu wechseln. Ein solcher Zynismus kann nur der Geburtsstätte des wuchernden Neoliberalismus entstammen – heimlich dürfte so mancher Staat aber den blanken Pragmatismus einer solchen Aussage feiern.
Die Nachricht ist klar: Wir brauchen Kultur, ja, im Idealfall sollte der Kulturschaffende aber, da er ja eh nichts mit Kapitalismus am Hut haben will, sein Produkt umsonst anbieten. Als Gemeingut, sozusagen. Dass der Rat des britischen Kulturministeriums, sollte er dann von Resignation und Kapitulation seitens der Kulturschaffenden gefolgt sein, uns um eine Menge Meisterwerke bringen wird, die nie geschrieben, komponiert, aufgenommen und produziert werden, scheint der Regierung egal zu sein.
Die Kehrseite der Digitalisierung
Da kommt der kulturelle Demokratisierungsprozess qua digitale Bibliotheken gerade recht: Mittlerweile können ganz viele Menschen ganz viel Kultur völlig legal für wenig Geld konsumieren. Auf Spotify, Netflix und Co. gibt es doch so viel zu entdecken. Sogar der Fan musikalischer Nischengenres braucht ewig, bis er sich an den vielen von Algorithmen vorgeschlagenen Neuentdeckungen satt gehört hat. Sie ahnen, worauf ich hinauswill: Wer braucht schon neue Musik, wenn wir in dem Wust an zu jeder Zeit verfügbaren Platten stets etwas Neues entdecken können, oder dazu verleitet werden, Altbekanntes wiederzuentdecken?
In diesem Kontext kriegen Geburtstagsfeiern von Platten, die im Zeitalter der CD zu üppigen und oftmals schweineteuren Neuauflagen für Hardcore-Fans und Sammler führten, eine ganz andere Bedeutung: Was, wenn die Zeit, die wir damit verbringen, Radiohead, Placebo oder gar Linkin Park wiederzuentdecken, ein Todschlagargument für Budgetkürzungen im Kulturbetrieb wäre?
Mein Standpunkt soll ein anderer, weniger am Zynismus der Marktwirtschaft angelehnter sein: Die Wiederentdeckung eines musikalisch wertvollen Monats, in dem ich drei in der Popkultur als wichtig erachtete Platten hervorhebe – Radioheads „Kid A“, erschienen am 2. Oktober 2000, Placebos „Black Market Music“, erschienen am 9. Oktober, Linkin Parks „Hybrid Theory“, erschienen am 24. Oktober –, soll vielmehr Aufschluss darüber geben, wie wichtig es gerade jetzt ist, kulturelle Weiterentwicklung zu unterstützen.
Hätte Radiohead sich nicht, dank des überaus erfolgreichen Vorgängeralbums „OK Computer“ (1997), gut besuchter Konzerttourneen und eines Plattenvertrags mit EMI, die Freiheit erkauft, alles, was einem an Pawlow-Reflexen antrainiert wurde, wenn man in den 90ern in einer Indie-Brit-Pop-Band spielte, über Bord zu werfen, hätte es das experimentelle Meisterwerk „Kid A“ nie gegeben. Und hätte es Radioheads „Kid A“ nicht gegeben, wäre die zeitgenössische Musiklandschaft eine andere.
What If?

Wie so viele auf Beobachtung, Fakten und Kontext basierende „What if“-Szenarios ist auch dieser keine reine Spekulation. Fakt ist: Nach „Kid A“ gab es eine Reihe Acts, die an den Erfolg und die Unverfrorenheit dieses Werks anknüpfen wollten – ohne zu merken, dass das Nachahmen eines wagemutigen künstlerischen Aktes oftmals alles andere als mutig ist.
Viel mehr aber noch als „OK Computer“, das quasi die Vollendung gitarrenlastigen Indie-Rocks verkörperte, führte „Kid A“ zu einem Paradigmenwechsel in der zeitgenössischen Popmusik: Exit Gitarrenmusik, Enter der 1997 bereits titelgebende Rechner – wobei dieser auf „OK Computer“ stets im Schatten der Gitarren stand. Nach „Kid A“ schlichen sich die Maschinen definitiv in die Popmusik und, wie man es rückblickend mit einer Korn-Referenz formulieren kann – they are here to stay.
Klar: Jemand anders hätte sein „Kid A“ an der Stelle von Radiohead schreiben können. Tat dieser jemand aber nicht. Und selbstverständlich gab es auch vor Radiohead elektronische Musik im Pop (man denke an Kraftwerk oder Depeche Mode). Aber auf „Kid A“ verstand es Radiohead wie keine Band zuvor, Avantgarde-Elektro (also nicht bloß ein paar billige Beats oder käsige Synthie-Streicher aus der Konserve) mit den Idiosynkrasien des Indie-Rock zu verbinden. Hätte man 1999 einen Musikjournalisten gebeten, sich eine Platte vorzustellen, die das fehlende Bindeglied zwischen Indie-Rock und den Avantgarde-Experimenten eines Aphex Twin darstellt – dieser hätte vehement und besserwisserisch den Kopf geschüttelt. (Fast) pünktlich zur Jahrtausendwende war sie dann da.
Wer „Kid A“ heute wiederhört, wird feststellen – und das mag jetzt allmögliche kulturjournalistische Klischees bedienen –, dass die Platte wahnsinnig gut gealtert ist. Der Franzose sagt dazu: ne pas avoir pris une ride. Der Vergleich stimmt: „Kid A“ hat keine einzige „Falte“ bekommen. Würde in den Produktions-Credits stehen, die Platte wäre vor ein paar Monaten aufgenommen worden – man würde es sofort glauben.
Die warmen Synthies, die zu Beginn des ironisch betitelten Openers „Everything In Its Right Place“ Thom Yorkes redundante Lyrics begleiten, die dissonanten Saxofone auf „National Anthem“, der schaurig-schöne Ambient von „Treefingers“, das unverschämt tanzbare „Idioteque“, das bereits 2000 den ökologischen Weltuntergang beschwört: Kein Song auf „Kid A“ klang wie etwas, das man vorher schon mal gehört hatte. Selbst konventionellere Tracks wie die Ballade „How To Disappear Completely“, das rockige „Optimistic“ oder der Indie-Track „Morning Bell“, den die Band ein Jahr später auf „Amnesiac“ in einer viel kälteren Variante deklinierte, klangen anders, ungewohnt, neu. Nach einem Jahrzehnt Britpop und Grunge wurde Musikhören wieder spannend. Radiohead zwang die Zuhörer dazu, umzudenken, ihren musikalischen Habitus aufzugeben.
Und das war möglich, weil Radiohead nicht nur einen symbolischen, sondern auch einen realen Stellenwert auf dem Markt hatte. Wenn Bands aber heute kaum mehr Gewinn durch Plattenverkauf erwirtschaften – man weiß, wie wenig Geld Musiker von Streamingdiensten erhalten – und wegen der Pandemie keine Konzerte spielen können (auf Konzerten macht man Gewinn durch Kartenverkauf, ein beachtlicher Teil wird aber auch durch den Verkauf von Merch eingespielt), bleibt die Frage, ob heute Meisterwerke wie „Kid A“ überhaupt noch entstehen könnten, legitim.

Verkannte Propheten?
Ein Wiederhören einer markanten Platte ist eine Zeitreise mit Aktualitätsvergleich. Wenn man damals bloß gewusst hätte, was man heute – leider – weiß. Ja, was denn? Eigentlich gar nichts. Man kann nur Gewicht oder Leichtigkeit einer Epoche messen – dieses Wissen ist allerdings unnütz, da weder Musiker noch Kritiker irgendwas von dem, was nach der Veröffentlichung der Platte passierte, in ihren Schaffensprozess oder die Analyse einbringen konnten. Im Oktober 2000 war die Welt noch eine heile, liest man in heutigen Geburtstagsberichten zu „Kid A“ – sicherlich nicht für jeden, und dies zu behaupten wirkt teilweise wie ein Todschweigen allmöglicher Fortschritte feministischer oder ökologischer Natur (2000 war Weinstein auf freiem Fuß und die Mehrheit der Menschheit wusste nicht, was ein ökologischer Fußabdruck ist).
Aber dennoch: 2000 war die geopolitische Welt mehr oder weniger in Ordnung. Der Kalte Krieg war Schnee von vorgestern, die Attentate auf das World Trade Center noch fast ein Jahr entfernt, Wirtschaftskrisen, Pandemien und Attentate auf Satire-Zeitungen und Konzertgänger waren größtenteils der Vorstellungskraft von Filmemachern und Schriftstellern vorbehalten.
Es wäre ein Leichtes, die dunkle, postapokalyptische Stimmung, die auf „Kid A“ herrscht, als prophetisch zu bezeichnen. Ein Kunstwerk ist jedoch niemals prophetisch. Selbst Orwells „1984“ ist es nicht. Schriftsteller, Musiker und Künstler betrachten die Aktualitätsfäden, die vor ihnen liegen – und extrapolieren daraus mögliche Welten, komponieren Stimmungen, die sich in Klangflächen ausdrücken. Manchmal entstehen Klangbilder, Kunstwerke und Texte, die mit der Nachwelt übereinstimmen. Dabei handelt es sich manchmal um schöne, oft um weniger schöne Zufälle. Je mehr der Kulturschaffende aber dem Diskurs der Welt und den Menschen zuhört, desto klarer kann er Intuitionen formulieren.
Auf „Kid A“ haben Radiohead ihre Intuition bezüglich einer möglichen Entwicklung der Welt überdeutlich gezeichnet. Themen wie das ökologische Desaster, auf das wir hinsteuern („Idioteque“), aufkommende Nationalismen („The National Anthem“), wirtschaftlicher Darwinismus („Optimistic“) oder auch der Wunsch, einfach mal unterzutauchen („How To Disappear Completely“) werden hier dennoch in reinster Thom-Yorke-Manier eher abstrakt umrissen und in ein musikalisch spannendes Gewand eingewoben, als dass sie konfrontativ erwähnt werden.
Eine kurze Entstehungsgeschichte
„Kid A“ ist ein totales Werk – vom enigmatischen Artwork des noch enigmatischeren Stanley Donwood über die Entstehungsgeschichte der Platte, der eine Reihe kultiger wie auch bandzersetzender Mythen anhaften (weil Thom Yorke plötzlich keine Gitarren mehr wollte, sollen sich einige Bandmitglieder im Studio entbehrlich gefühlt haben), bis hin zur defizitären Tournee in einem mobilen Zirkuszelt oder dem ein Jahr später erschienenen, ebenso grandiosen Zwillingsalbum „Amnesiac“: Wer von „Kid A“ spricht, spricht niemals nur über „Kid A“.
Die Geschichte von „Kid A“ beginnt mit einer Verweigerungshaltung: Nachdem „OK Computer“ den Ruf Radioheads als der eine der wichtigsten Bands der Welt zementiert hatte – daran waren sowohl die tollen Songs als auch die Texte und Videos über Paranoia und Technophobie nicht unbeteiligt –, wäre es ein Leichtes gewesen, dieselbe Platte mit ähnlichen Songs noch einmal zu schreiben. Weil sich aber eine Menge anderer Bands bereits erfolglos daran versucht hatten, das „OK Computer“-Rezept zu kopieren und weil Radiohead sich wohl irgendwann vorgenommen haben muss, sich niemals zu wiederholen, sperrte man sich ins Tonstudio ein, ließ die Gitarren größtenteils draußen, entschied sich gegen die Veröffentlichung von Vorab-Singles – und veröffentlichte am 2. Oktober 2000 eine experimentelle Weltuntergangsplatte, die auf Platz eins in den englischen und US-amerikanischen Charts landete.
Die Welt lag Radiohead zu Füßen – Radiohead drehte ihr nicht etwa den Rücken, sondern forderte sie auf, den fünf Musikern ins musikalische Ungewisse zu folgen, ohne sich, wie im Orpheus-Mythos, umzudrehen, um die Ruinen der 90er zu betrachten. Dass diese Zukunft so ungewiss war, dass manche Bandmitglieder selbst nicht wussten, wo Sänger Thom Yorke und Gitarrist Johnny Greenwood hinwollten, ist aus heutiger Sicht nicht mehr als eine weitere spannende Anekdote, die die sagenumwobene Entstehungsgeschichte der Platte vervollständigt.
Kristallkugel

Man kommt einfach nicht darum herum: Die Gegenwart bleibt unser aller unschöner Messstab. Und wir wissen heute, was wir damals nur erahnen konnten. Linkin Park hat sich nach einer letzten, richtig miesen Pop-Platte und dem Suizid von Sänger Chester Bennington aufgelöst, Placebo ist je nach persönlicher Toleranzgrenze ein oder zwei Alben nach „Black Market Music“ in die Belanglosigkeit abgedriftet – nur Radiohead gilt auch heute noch (fast) unangefochten als Meister von kompromisslosem Indie-Rock und Avantgarde-Elektro.
Aber wie wir bereits schrieben – früher (im Allgemeinen) und im Jahr 2000 (insbesondere) war alles besser. Am 9. Oktober veröffentlicht Placebo mit „Black Market Music“ ihre dritte und vielseitigste Platte, zwei Wochen später erscheint Linkin Parks Debüt „Hybrid Theory“ – eine Platte, die mit Mike Shinodas Rap-Einlagen, Chester Benningtons Wechsel zwischen cleanem Gesang und energischen Shouts sowie zornigen Gitarren und Beats den Nerv der Zeit trifft – und inmitten des Nu-Metal-Hypes erst mal riskiert, unterzugehen.
Die Deftones haben gerade „White Poney“, Korn „Issues“ und Limp Bizkit „Chocolate Starfish …“ veröffentlicht – wer braucht da noch eine weitere Nu-Metal-Band, zumal Kritiker und Fans zugleich den Eindruck habe, dass jenseits des Rap-Metal-Hybrids nicht mehr so viel Spannendes folgen wird. Linkin Park aber trumpft auf mit Shinodas markanten Rap-Parts, Benningtons ehrlichen Lyrics über sexuellen Missbrauch und Depression, den diskreten Samples und vor allem einem Pop-Appeal, der Nu Metal plötzlich salonfähig macht – auch wenn die Musik hauptsächlich aus den Zimmern rebellischer Teenies tönt – und die Band von Beginn an in eine Identitätskrise stürzt.
Linkin Park hat zu viel Pop-Appeal, um in Fachkreisen ernst genommen zu werden, ist aber für den Mainstream, der stets nur eine Handvoll Songs im Radio spielen wird, zu laut. Es ist eben jenes Polarisieren, das die Band über den langsamen Tod des Nu-Metal hinüberretten wird: Linkin Parks Wiedergeburt im Pop wird es der Band mit mehr oder weniger Erfolg erlauben, Unterschlupf in anderen Genres zu finden.
Wer Chester Benningtons existenzielle Texte damals als auf Teenage Angst gemünzte Klischees abtat, wird nach seinem Freitod an sich simple Textzeilen wie den Chorus des Klassikers „Crawling“ („Crawling in my skin/These wounds they will not heal/Fear is how I feel/ Confusing what is real“) schlicht und einfach ergreifend finden – und dies, ohne psychopathologische Analysen anzustellen oder über die Trennung von biografischem Leben und künstlerischem Schaffen sinnieren zu müssen.

Überhaupt: Schnell wurde Nu-Metal als peinliche Nebenerscheinung eines von Crossover geprägten Zeitgeists klassifiziert, man vergisst heute aber (zu) schnell, dass die Genregeburt auf die Experimentierfreudigkeit einer Band wie Faith No More zurückgeht, dass der Nu-Metal uns Bands wie die Deftones gebracht hat – und dass selbst später weniger beliebte Genre-Vertreter wie Korn oder eben Linkin Park gute Songs schreiben konnten. Die Produktion von „Hybrid Theory“ mag heute ein wenig dünn wirken – der Bass ist, wie bei vielen Metal-Bands, Nebensache, die Power-Chords klingen hier und da ein wenig schal –, Songs wie der Opener „Papercuts“ und Klassiker wie „One Step Closer“ oder eben „Crawling“ sind erstaunlich gut gealtert und zeigen, dass die Rap-Metal-Freundschaft doch nicht immer so verkehrt war, wie man uns heute glauben lassen will.
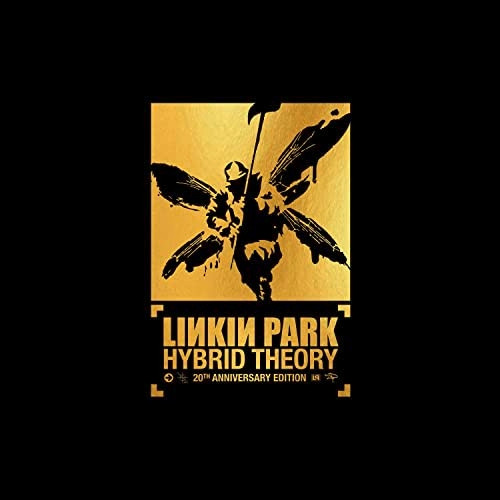
Drogen, Identitätssuche, Sex und Kapitalismus
Auf „Black Market Music“, der dritten Platte von Placebo, waren Songs und Produktion zwar bereits weichgespülter als auf den ersten beiden Alben der Engländer, die wegen Brian Molkos androgyner Stimme stets polarisierten, dafür erweiterte man aber das Klangbild um ein paar stilistische Exkurse in Richtung Industrial („Taste in Men“) oder Nu-Metal („Spite and Malice“) und überzeugte mit ausgefeiltem, abwechslungsreichem Songwriting – „Black Market Music“ ist vielleicht das letzte Placebo-Werk, das (fast) ohne Füllmaterial auskommt. Textlich wirkt die Band nach der internationalen Anerkennung und der Zusammenarbeit mit David Bowie auf „Without You I’m Nothing“ selbstsicherer, die Songtexte sind kristallklar, ohne dass Brian Molko wie in späteren Tagen in plakativ-banale Statements abdriftet.
Neben sexueller Identität („Taste in Men“) besingt Placebo hier exzessiven Drogenkonsum („Commercial for Levi“, „Special K“, nach Eigenaussage dauerten die Aufnahmen der Platte aufgrund intensiven Drogenkonsums länger als geplant), Rassismus („Blue American“) oder Ennui und Ausbeutung des arbeitenden Bürgers („Slave To The Wage“). Die Band klingt zuversichtlicher und gelassener, bleibt aber stilistisch und textlich auf der Suche: Industrielle Klänge à la Nine Inch Nails („Taste In Men“) stehen neben akustischen Glockenspielnummern („Commercial For Levi“), klassischem, von Pavement inspiriertem Indie-Rock („Slave To The Wage“) oder härteren Indie-Nummern („Haemoglobin“). Ein paar Platten später hat die Band ihre Identitätssuche gegen eine bequeme Haltung als letzte Bastion alternder Indie-Rock-Helden und Ex-Enfants-Terribles eingetauscht – auf „Black Market Music“ jedoch bleibt das britische Trio mit luxemburgischen Wurzeln relevant und spannend.
Die Feierlichkeiten fallen für jede der drei Platten anders aus: Während Linkin Park ihr „Hybrid Theory“ in einer Reihe verschiedener Auflagen neuauflegt und vom Fan schon mal stolze 200 Euro für ein liebevoll zusammengestelltes Ensemble aus Remixes, Demos oder unveröffentlichten Songs verlangt, bietet Placebo vier Episoden Videomaterial rund um die Entstehungsgeschichte der Platte. Radiohead hatte sich im April Gedanken über eine Geburtstagsauflage gemacht, bisher warten die Fans aber vergeblich auf konkretere Informationen. (1)
Hier liest sich die Verzweiflung der Musikindustrie, die weiß, dass man mit Sonderauflagen zwar noch einige Fans bedienen kann, die meisten aber längst materielle Sammlungen zugunsten einer schier unendlichen digitalen Bibliothek aufgegeben haben, in der Algorithmen und Playlist den Ton angeben. Genre-Zugehörigkeiten wie Brit-Pop (Radiohead), Indie-Rock (Placebo) oder Nu-Metal (Linkin Park) sind längst zugunsten eines wilden kulturellen Potpourris verschwommen. Auch dies – das Auflösen im digitalen Vortex, die soziale Enthierarchisierung des Musikhörens durch die Universalisierung des Zugriffs auf digitale Bibliotheken – hatte Radiohead voraussehen können.
(1) Nachdem die Briten EMI verließen, legte das Label sämtliche beim Label erschienenen Platten in sorgfältig konzipierten Special Editions neu auf, weswegen eine erneute Wiederveröffentlichung vielleicht redundant wäre.
- Barbie, Joe und Wladimir: Wie eine Friedensbotschaft ordentlich nach hinten losging - 14. August 2023.
- Des débuts bruitistes et dansants: la première semaine des „Congés annulés“ - 9. August 2023.
- Stimmen im Klangteppich: Catherine Elsen über ihr Projekt „The Assembly“ und dessen Folgeprojekt „The Memory of Voice“ - 8. August 2023.



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos