Deutscher Buchpreis / Um was geht es?

Ein Vater reist mit seinem Sohn in das Hügelland, aus dem seine Familie stammt, um den Geistern seiner suizidgetriebenen Vorväter gegenüberzutreten: „Serpentinen“ ist ein soziologisch gefärbter Roman über psychische Krankheit, die deutsche Vergangenheit und Loslassen.
„Familienbla“ nennt es der Erzähler von „Serpentinen“ – „die Ereignisschilderung, die jedes Mitglied der Familie Wort für Wort mitsprechen konnte“, das Narrativ, das aus Legenden und ein paar wiederkehrenden Anekdoten besteht, die eigentlich nur dazu dienen, den Mantel des Schweigens, unter dem man die wahre Familiengeschichte verbirgt, erzählerisch bunt zu gestalten.
„Serpentinen“ beginnt in medias res: Der Erzähler, ein gelehrter Soziologe, der einer von Depressionen und Gewalt geprägten Familie entkommen ist, fährt mit seinem Sohn die Schwäbische Alb auf und ab – weil ein Vater „gute Erinnerungen“ für seinen Sohn schafft. Beide übernachten in einem zum Hotel umfunktionierten alten Bahnhof, tagsüber klappern sie Etappen der Familiengeschichte ab. Von der Außenwelt hat er sich abgeschottet, sein Telefon bewahrt er in einer Blechdose auf – damit niemand ihn erreichen oder lokalisieren kann.
Im Laufe des Romans besucht der Erzähler seine demente Mutter, deren Gedächtnis fast „abgetragen“ ist – „Schicht für Schicht, bis hinunter zum Plusquamperfekt“. Er erinnert sich an seine Kindheit, an die von gewalttätigen Vätern verprügelten Klassenkameraden, gedenkt seines toten, kunstaffinen Freunds Frieder, dank dem er begann, einer Welt, in der Kunst „für Bonzen und Schwuchteln“ und „nur körperliche Arbeit etwas wert“ ist, zu entkommen, trifft Frieders Bruder Mischa, mit dem er sich über Didier Eribon, Klassenkampf und Gerhard Schröder unterhält („Man kann seine Klasse nicht verlassen. Man kann sie nur verraten“) und erinnert sich an den aggressiven Stiefvater, den er später dafür mochte, „dass er immer so ein klares Arschloch gewesen war“.
Seine Gedanken kreisen immer wieder um den „Alkohol des Vaters, die Suizidversuche, den Suizid“. Den eigenen Trübsinn spült er mit Dosenbier herunter, die Angst vor dem Versagen verschwindet jedoch genauso wenig wie die deutsche NS-Vergangenheit, an die ihn jedes ländliche Detail erinnert. So stellt ein Bach, den eifrige Stadtplaner wiederentdeckt und freigelegt haben, für ihn das „prototypische Faschismusbächlein“ dar: „Versteckt und eingedolt, nach ein paar Jahren wieder rausgeholt und vorgezeigt, kanalisiert, schaut alle mal her, wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Psycho-, Sozio-, Hydrologie.“
Legenden, Lügen, Familienbla
Um seiner Vergangenheit zu entkommen, hat sich der Erzähler der Wissenschaft verschrieben, den Ungereimtheiten des „Familienblas“ will er Fakten und Daten entgegensetzen, weniger um das Lügennetz zu konterkarieren, als um sich mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten zu konfrontieren – die Alkoholsucht, die Depressionen, die Angst vor dem Selbstmord, die Gewissheit, den eigenen Sohn zu enttäuschen.
Unter befreundeten Soziologen beschleicht ihn dennoch ein Gefühl der Entfremdung, sein Studiengang hat ihn mit den Werkzeugen ausgestattet, die es ihm erlauben, seine Position als Emporkömmling im akademischen Milieu klarsichtig einzuschätzen. „Ich war zu gut in meinem Fach: Ich erkannte in jedem freundlichen Wort die Mechanik des Betriebes, die es erzwang.“ Von seinen Arbeitskollegen – „fleißige Spinnen beim Networking“ – unterscheidet er sich, da diese den Zweifel als kartesianisches Intellektuellen-Gehabe pflegen, wo er einfach nur zweifelt. Ihm fehlt die „neutrale Herkunft“ – in diesem Milieu ist neutral mit „bildungsbürgerlich“ gleichgesetzt. „Ich misstraute der Soziologie. Ich misstraute dieser Larmoyanz. Das Individuelle wurde typisiert, wurde zurechtgebogen, bis es ins Klischee passte und ins Ressentiment und in die stimmige, ad hoc einleuchtende Geschichte. Legenden, Bla, Theorie. Und wieder: Grobe Pinselstriche malten alles schön deutlich und klar. Pop-Art-Lebensläufe.“
„Um was geht es?“, fragt der Sohn immer wieder. Um die Serpentinen, antwortet der Vater. Die titelgebenden Serpentinen sind die kurvigen Landstraßen der Heimat, es sind die Schlangenlinien, die der Erzähler fährt, nachdem er die ersten paar Biere gekippt hat, es ist das Fragezeichen, das dem Erzähler im Gesicht steht, nachdem man ihm im Suff die Nase brach, es ist die Schlinge des Seils, mit dem der Vater sich erhängt hat, es sind die Umwege, die man macht, um der Wahrheit nicht ins Gesicht blicken zu müssen.
Die Wahrheit, das ist der Vater, der gerne ein Nazi gewesen wäre und „noch viele Jahre nach dem Ende der NS-Zeit den Massenmord an den Juden ungeniert guthieß“, sie ist das Seil, das später wieder „bei den anderen Seilen“ hing, weil ein nüchterner Pragmatismus das Familienethos ausmacht („mit einem Seil, an dem sich einer erhängt hatte, konnte man ein Gerüst ebenso gut an der Hauswand festbinden wie mit jedem anderen Seil“), sie ist der Geruch des Erbrochenen, der beim Erzähler Erinnerungen an den Vater auslöst – eine Proust-Madeleine für die Arbeiterklasse.
„Du mit deinen Nazis“
Wie auch Deniz Ohdes „Streulicht“ erzählt „Serpentinen“ von Männern, deren Gewaltausbrüche gesellschaftlich konditioniert sind – und die ihre angestaute Frustration an geschichtslosen Möbelstücken oder an sich selbst auslassen, weil sie die angeborene Gewalt nicht am Partner oder Kindern auslassen wollen.
In seiner fragmentierten Erzählung konfrontiert Bergs Figur stets Fiktion und Fakt: Als er sich daran erinnert, wie er den Vater in die Wirtschaft holen musste, erwähnt er „die Bibliothek der Säuferväterbücher“, die „Bibliothek der Hohen Losgeschickt-den-Vater-aus-der-Wirtschaft-zu-holen-Literatur“ und die „Bibliothek der Hohen Anschreiben-lassen-für-Alkohol-Literatur“. Aus der Vielzahl soziologisch angefärbter Familienerzählungen ergibt sich ein literarisches Erbe, schält sich ein dominantes Narrativ heraus, eine versoffene Anthologie, deren Summe weder Trost spendet noch die Trauer individueller Erfahrungen literarisch zu transzendieren vermag.
Die Soziologie verallgemeinert, wo die Literatur eine Gemeinschaft erdichtet, die in Wirklichkeit gar nicht existiert: Der Erzähler navigiert inmitten dieser Fiktionen, ist sich der Sinnlosigkeit des Erzählakts schmerzhaft bewusst. Ein Lösungsansatz ist das nüchterne, schonungslose Berichten, das sich im konfrontativen Erzählstil des Romans ergibt: Bergs „Serpentinen“ sind ein verbaler Faustschlag in die Magengrube, die Erzählung ist elliptisch, die Sätze kurz, rotzig, fast aphoristisch, nur manchmal wirkt die gesuchte Vulgarität etwas aufgesetzt, das erzählerische Tourette ein wenig effektheischend.
Ein weiterer Lösungsansatz ist das humorvolle Zerlegen der Feindbilder – da wären einerseits der verspielte Vater, dem sie beim Spaziergang durch den Wald begegnen und der seinem Sohn die Welt als Abenteuerland zusammenlügt, andererseits aber auch der klischeehafte Vorbildvater aus amerikanischen Filmen, der seinen Sohn zum Angeln mitnimmt: „Der Vater erzählte davon, dass er einmal mit seinem Vater, also dem Großvater, zum Angeln gewesen sei und dass der Großvater ihm, dem Vater, erzählt habe, dass er einmal mit seinem Vater, also dem Urgroßvater, zum Angeln gewesen sei und dass der Urgroßvater ihm, dem Großvater, erzählt habe, dass er, der Urgroßvater, einmal mit seinem Vater, also dem Ururgroßvater, zum Angeln gewesen sei, und das Erzählen geriet von der Vorvergangenheit in die Vorvorvorvergangenheit, ins späte Pleistozän, ins Paläogen, in die Kreide, ins Jura. Ein Ammonitenvater trieb mit seinem Jungen auf dem Boot über das Thetysmeer, warf die Raspelzunge aus und erzählte. Dann schwiegen sie wieder.
Wie bei Cormac McCarthys „The Road“ sind die Figuren namenlos, der Sohn des Erzählers ist schlicht „der Junge“, als wolle der Erzähler eine Allegorie aus allen namenlosen und geschichtslosen Provinzschicksalen flechten, als wäre der Roman zeitgleich eine Abrechnung mit Bourdieu als auch eine soziologische Fallstudie. Waten Vater und Sohn in „The Road“ allerdings durch Schutt und Asche einer zerstörten Außenwelt, so zeichnen Bjergs „Serpentinen“ eine Apokalypse der Intimität.
Der langsame Zerfall einer Welt, die sich der Erzähler im Verzahnen von Familienlegende und Faktensammlung zusammengestellt hat, liest sich im langsamen Auflösen der Wirklichkeitsdarstellung gen Ende des Romans. Weil die immergleichen Fliesen des Hotelbadezimmers ihn zu sehr an einen Selbstmordversuch des Vaters erinnern, beginnt er, sie mit kindlichen Motiven zu übermalen – und gibt somit die methodische, wissenschaftliche Selbstzeichnung auf, um sich letztlich doch dem familientypischen Vergraben, dem Vertuschen, dem Verdecken hinzugeben. Soziologie: 0. Familienbla: 1.
Info
Bov Bjerg, „Serpentinen“, Ullstein 2020, 274 Seiten, 22 Euro
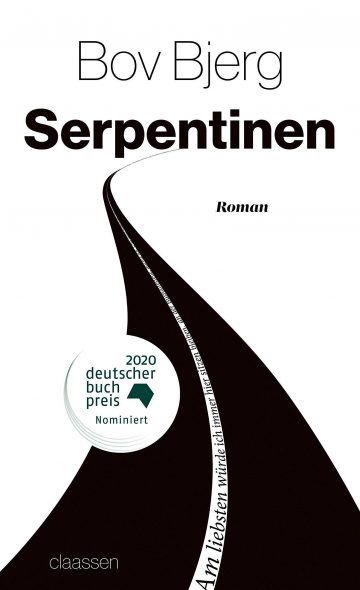



 Headlines
Headlines









 Umfrage
Umfrage
 Facebook
Facebook  Twitter
Twitter  Instagram
Instagram  LinkedIn
LinkedIn
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.
Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos